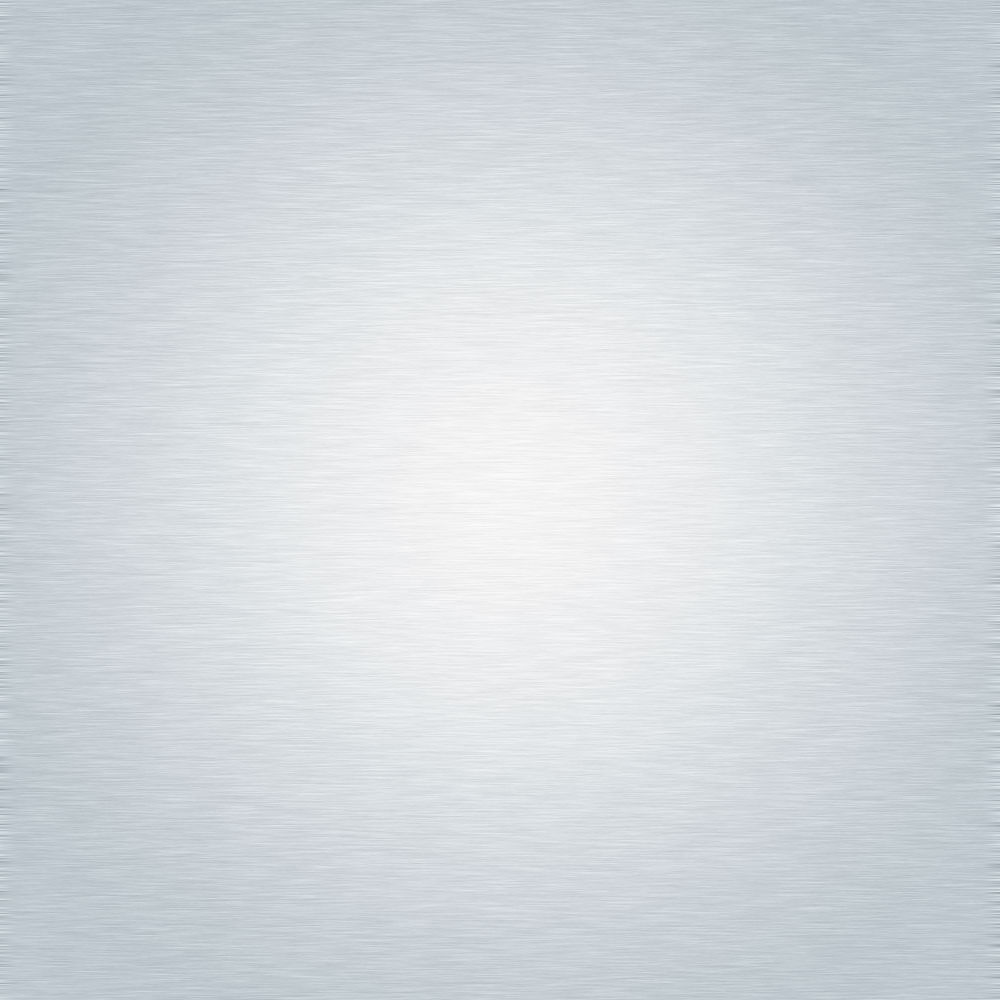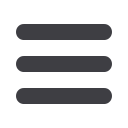
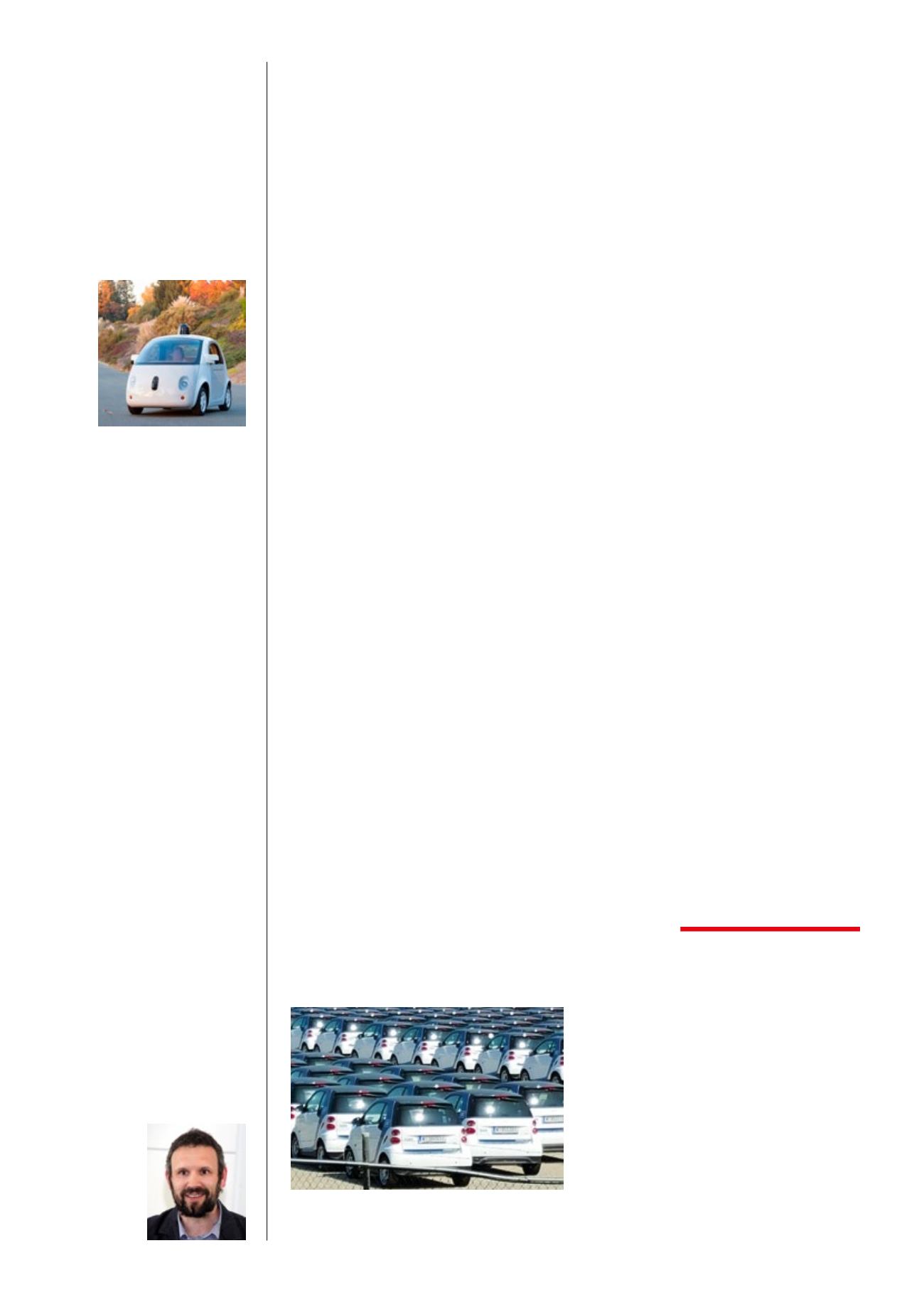 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt
AK Stadt · Seite 12
DI Christian Pichler
ist
Stadtplaner und Mit-
arbeiter der Abteilung
Kommunalpolitik der
AK Wien
MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Die Grenzen der Innovation
Vom Elektro- zum selbstfahrenden Auto – die rollende E-Zukunft klingt viel
versprechend, doch steckt sie im Versuchs-Modus. Ob sie die wachsenden
Wiener Verkehrsprobleme lösen kann, ist höchst fraglich.
Von Christian Pichler
Aufmerksamkeit, die ihnen medial zuteil wird,
muss hinterfragt werden. Schließlich geht
es um die Aufrechterhaltung bestehender
Autolobby-Interessen und Optimierungspo-
tenziale vorhandener Infrastruktur.
Schlechte Umwelteffekte
Doch elektrische PKWs oder auch Autos mit
Hybrid-Elektro-Antrieb sind in der Stadt ein
absolutes Nischenprodukt. In Wien waren
2014 gesamt 683.250 PKWs zugelassen,
davon ganze 337 Elektroautos und bloß
3.352 Hybrid-Elektro-PKWs. Darüber hin-
aus ist individuelle E-Mobilität nicht per se
besser als die individuelle Fahrt mit Verbren-
nungsmotor. Denn Umwelteffekte müssen
immer mit einer Well-to-Wheel Energiebilanz
bewertet werden. Heißt: Über Effizienz und
CO
2
-Profil eines Fahrzeugs entscheidet
nicht alleine die Kombination aus Motor und
Getriebe. Ausschlaggebend ist die gesamte
Energiekette vom Rohstoff bis zum Rad.
Ganzheitlich betrachtet, schmelzen die mög-
lichen Vorteile des Elektroautos rasch dahin.
Außerdem erschweren die deutlich höheren
Fahrzeugkosten den Zugang für alle Bevölke-
rungsgruppen. Die individuelle, motorisierte
E-Mobilität mit PKW kann deshalb kein ver-
kehrspolitisches Ziel darstellen. Gerade
à
Fotos:ThomasRitt (1),JakobFielhauer (1),AKWien (1),Google (1)
Zusammengefasst
Elektrische oder selbstfahrende
Autos gelten als große Innova-
tion. Besonders für den motori-
sierten Einzelverkehr gilt: Auch
E-Motoren schaffen keine gute
Energiebilanz. Sinnvoll ist die
Elektromobilität im Öffentlichen
Verkehr – dort bewährt sie sich
seit Jahren als Massenver-
kehrsmittel, Straßen-, S- oder
U-Bahn beweisen es. E-Bikes
etwa könnten eine sinnvolle
Unterstützung des Öffentlichen
Verkehrs sein.
W
iener Science-Fiction für freie Straßen.
Die Zukunft bringt 700.000 möglichst
selbstfahrende Elektroautos. Ist das die Ziel-
vorstellung für eine städtische Verkehrspoli-
tik? Schlagworte künftigen Verkehrs prägen
die Berichterstattung: nachfrageorientiert,
flexibel, multimodal, nutzen statt besitzen,
umweltfreundlich, leistbar, praktikabel und
freilich smart. Einprägsame Worthülsen,
doch ob sie tatsächlich tragfähige Konzepte
bilden, um die Herausforderungen im Ver-
kehrsbereich zu lösen, ist fraglich.
Denn der Blick auf die Straße vermittelt ein
deutliches Bild. In den letzten Jahren ist das
Bevölkerungswachstum in der gesamten
Wiener Stadtregion stark angestiegen, das
führt auch zu mehr potenziellen Verkehrsteil-
nehmerInnen. Die neuen BewohnerInnen be-
wegen sich zur Arbeit, zur Ausbildung, zum
Einkauf oder in der Freizeit. Auch wenn der
Wiener Motorisierungsgrad zurückgeht, da
die Autoanzahl nicht im gleichen Verhältnis
wie die Bevölkerung wächst. In absoluten
Zahlen steigt der PKW-Bestand inWien nach
wie vor an. Radikaler ist die Entwicklung
jenseits der Stadtgrenze: der PKW-Bestand
wächst hier nach wie vor sehr dynamisch.
Unglückliche Perspektive: Mehr Verkehr,
doch besonders im Stadtgebiet lässt sich
der Platz dafür nicht beliebig erweitern.
Mit technischen Innovationen soll dieses
Problem gelöst werden – gerne werden
zwei Verkehrsneuheiten genannt: das
selbstfahrende und das Elektro-Auto. Die
Thema
WIEN WÄCHST
VERKEHR
Die ökologischen Vor-
teile des selbstfahren-
den Autos schmelzen
rasch dahin und sie sind
für sozial Schwache
kaum zugänglich
Auch Carsharing verbraucht Platz und ist ein Beitrag
zum Stau in der Stadt. Städtische Mietautos verführen
auch viele Menschen dazu Wege, die sie mit den Öffis
zurücklegen könnten, mit dem Auto zu fahren