
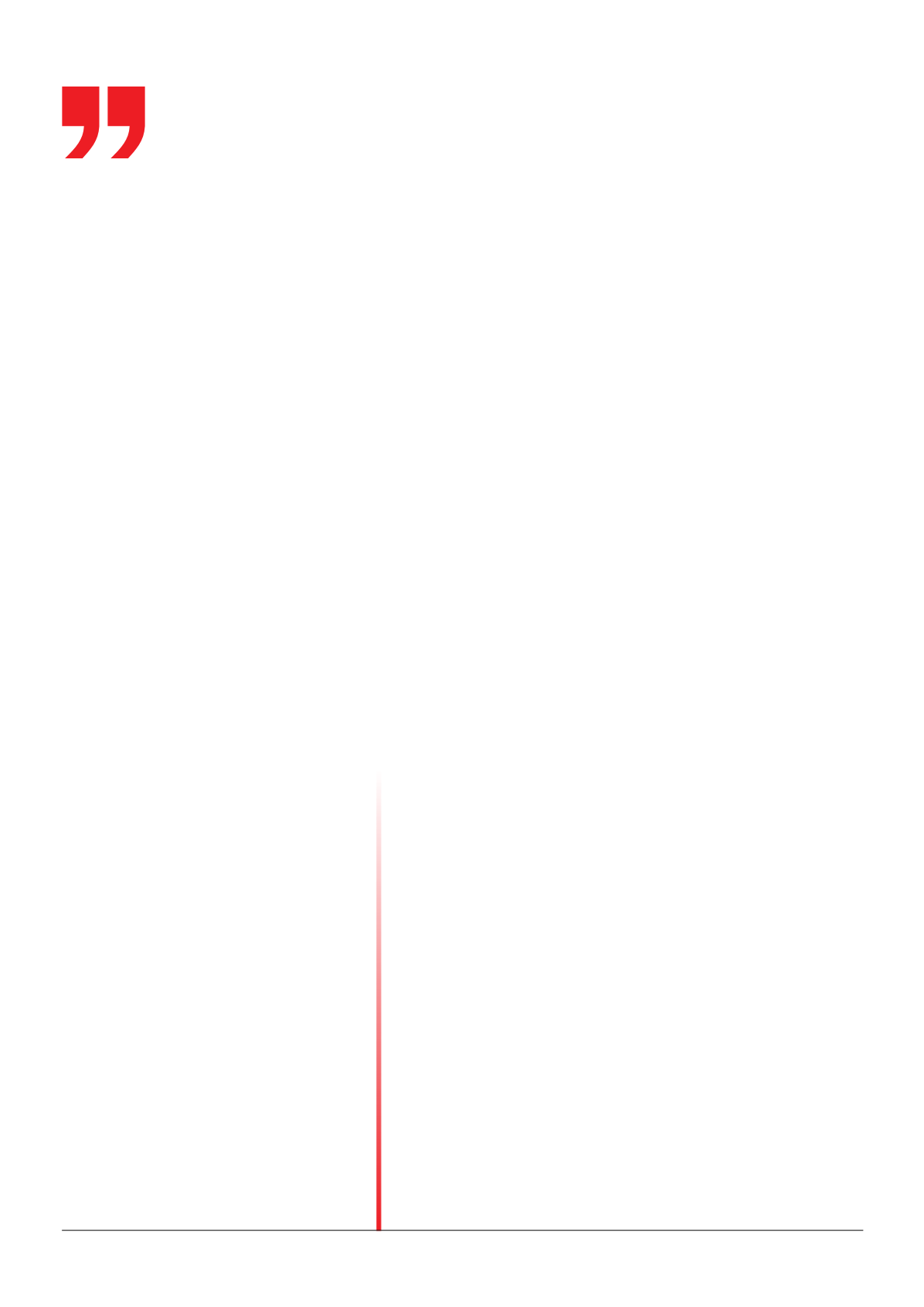
erkennbar und verschwand damit von
der Bildfläche. Selbst wenn kein Nitrat
mehr in den Boden eingebracht wird,
dauert es seine Zeit bis der Nitratgehalt
im Grundwasser abnimmt.
Grundwasserverträglichkeit
Auswertungen von Modellberech-
nungen ergeben, dass die aufgebrach-
te Düngemenge den entscheidende
Faktor bei erhöhter Nitratkonzentration
im Grundwasser darstellt. Dabei sind
alle Formen des Stickstoffeintrages
zu berücksichtigen, also mineralische
Düngung, Wirtschaftsdünger, Eintrag
aus der Atmosphäre wie auch der An-
bau von Leguminosen etc. Wesentlich
ist auch die Kenntnis der Qualität des
Düngers. Auch das Wissen über die
Erntemenge und den damit verursach-
ten Stickstoffentzug ist notwendig, um
den Bilanzüberschuss des Stickstoffs je
Hektar berechnen zu können. Genaue
Einschränkungen beim Aufbringen von
Nitrat sowie Feldaufzeichnungen dieser
Daten sind hilfreich, um bei Nitratverun-
reinigungen die Ursachen herausfinden
zu können. Beides könnte bei der Über-
arbeitung des Nitrat-Aktionsprogramms
verpflichtend eingeführt werden.
Seit Anfang der 1990er Jahre werden
auch Arzneimittelrückstände im Grund-
wasser nachgewiesen. In Österreich
wie auch in Deutschland wurden daher
2015 Studien zu dieser Thematik durch-
geführt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei
manchen Stellen Antibiotika sowie Arz-
neimittelrückstände aufgetreten sind,
allerdings in so geringen Konzentratio-
nen, dass keine humantoxikologischen
Auswirkungen zu befürchten sind. Den-
noch sind bei Vorhandensein die Ursa-
chen abzuklären – meist kommen die
Substanzen über die Kanalisation ins
Fließgewässer und so ins Grundwasser.
Zielführend wäre es, Grenzwerte für die-
se Substanzen in der EU-Trinkwasser-
verordnung einzuführen.
Die Trinkwasserversorgung ist in Ös-
terreich fast ausschließlich in öffentlicher
Hand – weltweit sind es rund 80 Prozent.
In England hingegen wurde die Wasser-
versorgung unter Margaret Thatcher in
den 1980er Jahre privatisiert, in Frank-
reich hat die Verwaltung durch die Pri-
vatwirtschaft langjährige Tradition. Aus
diesen Ländern haben sich auch welt-
weit aktive Wasserkonzerne etabliert.
Weltweite Nummer eins ist Veolia Water:
70.000 Beschäftigte in 65 Ländern, Um-
satz 11,3 Milliarden Euro; 100 Millionen
Menschen werden mit Trinkwasser ver-,
für 63 Millionen das Abwasser entsorgt.
Die Wasserkonzerne sind weltweit aktiv,
um die Wasserversorgung finanzschwa-
cher Kommunen zu übernehmen. Frei-
handelsabkommen wie TTIP oder CETA
könnten ihnen den Zugang zu Märkten
erleichtern. Die „Allianz der öffentlichen
Wasserwirtschaft“ in Deutschland kri-
tisiert, dass neue Formen der Dienst-
leistungen im Wasserbereich künftig
automatisch unter die Liberalisierungs-
verpflichtung des CETA fallen, wonach
für Dienstleitungen erstmalig der Ne-
gativlisten-Ansatz angewendet wird.
Dies erhöht den Druck auf öffentliche
Dienstleistungen, da nach dem Prinzip
„list it or lose it“ bereits dann Liberalisie-
rungsverpflichtungen vorliegen, wenn
keine entsprechende Ausnahme ver-
ankert wurde. Auch bereits vorgenom-
menen Liberalisierungen können nicht
mehr zurückgenommen werden, was
den Handlungsspielraum für künftige
Rekommunalisierungen einschränkt. In
der EU wurden in den letzten 15 Jah-
ren über 120 Rekommunalisierungen
im Wassersektor vorgenommen, dar-
unter Paris, Berlin und Budapest. Zwar
wird in CETA von beiden Parteien an-
erkannt, dass Wasser im Naturzustand
keine Ware bzw. kein Produkt darstellt,
also nicht den Bestimmungen dieses
Abkommens unterliegt. Allerdings gibt
es bereits in der EU-WRRL einen viel
weiteren Schutz. Im Erwägungsgrund
1 der WRRL heißt es: „Wasser ist kei-
ne übliche Handelsware, sondern ein
ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt
und entsprechend behandelt werden
muss“. Ein ausdrücklicher Ausschluss
der Wasserver- und Abwasserentsor-
gung aus Freihandelsabkommen wäre
daher dringend geboten.
¨
Grundwasserschutz:
nicht verhandelbar
Über Jahre hinweg war das Gebiet
südlich von Graz als Grundwasser-
schongebiet ausgewiesen, da es
seit den 1990er Jahre mit viel zu
hohen Nitratwerten im Grundwasser
kämpft. Trotz rückläufigem Trend war
es immer schwierig, die maximale
Grenze von 50 mg/l Nitrat einzuhal-
ten. 600.000 KonsumentInnen und
über 1.000 Hausbrunnen sind davon
betroffen. Das Land Steiermark
beauftragte daher das Forschungs
institut Joanneum Research, konkrete
Vorschläge zur Verbesserung der
Nitratsituation auszuarbeiten. Die For-
schungsergebnisse wurden auf eine
gesetzliche Basis gestellt. Seit 1. Jän-
ner 2016 ist das „Regionalprogramm
zum Schutz der Grundwasserkörper
Grazer Feld, Leibnitzer Feld und
Unteres Murtal“ gesetzlich bindend.
Landwirtschaftliche Bewirtschafter
müssen seitdem ein Betriebsbuch
führen, in dem sie innerhalb ei-
ner Woche nach einer land- oder
forstwirtschaftlichen Maßnahme den
Anbau, die Düngung, den Pestizidein-
satz usw. genau aufzeichnen. Damit
soll überprüfbar werden, welche
Schutzmaßnahmen tatsächlich wirken
und woher gegebenenfalls eine
Beeinträchtigung des Grundwassers
kommt. Die Düngung im Herbst ist –
bis auf wenige Ausnahmen – verbo-
ten, da die Studie zeigt, dass diese
für die Pflanzen wenig bringt, aber
das Grundwasser belastet. Zudem
sind für manche landwirtschaftliche
Bewirtschaftungen wasserrechtliche
Bewilligungen notwendig.
Wasserknappheit kann die Möglichkeit für
wachsenden Wohlstand und die Schaffung
von Arbeitsplätzen erheblich behindern.
www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 2/2016
Seite 13
















