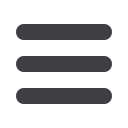

men wurden ein Element des neolibera-
len Umbaus globaler Gesellschaften.
Nicht ohne Grund formieren sich die
Gegenbewegungen mit ihrer Forderung
nach Klimagerechtigkeit weitgehend
außerhalb der etablierten Institutionen.
Die Koalitionen und Netzwerke, die sich
hinter der Forderung nach „Climate Ju-
stice Now“ versammelt haben, kritisie-
ren die neoliberale Hegemonie, doch ist
die Radikalität ihrer Forderungen sehr
unterschiedlich ausgeprägt.
Sozial-ökologische
Transformation
Aber eines dürfte inzwischen klar
geworden sein: die Klimaerwärmung
ist mit anderen Prozessen in komple-
xer Weise verbunden und sie kann nur
erfolgreich angegangen werden, wenn
die gesellschaftlichen Interessen und
die damit verbundenen Machtverhält-
nisse thematisiert und kritisiert werden.
Das ist letztlich die Herausforderung
einer sozial-ökologischen Transforma-
tion, die auch die Institutionen transfor-
mieren muss, mit denen gesellschaftli-
che Naturverhältnisse gestaltet werden
– in unserem Fall die Institutionen der
internationalen Umweltpolitik. Und für
einen solchen Umbau der Gesellschaf-
ten müssten sich auch neue Allianzen
und Bündnisse bilden. Bislang konnte
die Hegemonie neoliberaler Denkmus-
ter zwar angekratzt, aber noch lange
nicht überwunden werden. Wenigstens
in diesem Punkt stehen wir noch am
Anfang.
¨
Eine sozial-ökologische
Transformation bedeutet
auch eine Transformation
der Institutionen, mit
denen gesellschaftliche
Naturverhältnisse gestaltet
werden.
www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 4/2015
Seite 21
Was sind für aufstrebende Volks-
wirtschaften wie Brasilien die
zentralen Fragen bei der COP 21?
Moreno:
Länder, meist des globalen
Nordens, wollen das Grundprinzip
der Klimakonvention 1992, das
bezüglich des Klimawandels zwar
gemeinsame, aber unterschiedliche
Fähigkeiten und sich unterschei-
dende Verantwortlichkeiten von
Menschen und Ländern (CBDR–RC)
anerkennt, in Frage stellen und um-
schreiben. Wachsende Wirtschaf-
ten des globalen Südens, z.B. die
BRIC-Länder, sollen praktisch gleich
behandelt werden wie Industrielän-
der. Das geht nicht. Schon alleine
wegen des kolonialen Ballasts, der
zu einem großen Teil für die Un-
gleichverteilung in der Welt verant-
wortlich ist. Niemand will sich vor
seinen Verpflichtungen drücken.
Deshalb schlägt Brasilien vor, dass
„entwickelte Entwicklungsländer”
gemäß ihrer wachsenden Wirtschaf-
ten sukzessive mehr Verpflichtungen
übernehmen (Concentric Differentia-
tion Approach).
Welche Rolle spielt die Handels-
politik der Industrieländer bei der
Erreichung der Klimaschutzziele?
Moreno:
Ein Hauptverursacher der
Emissionen ist die Globalisierung
der Wirtschaft. Man muss wissen,
dass die Emissionen der großen
Fahrzeuge, der Schifffahrt oder
des Flugverkehrs nicht eingerech-
net werden, weil eine Vorgabe der
Klimakonferenz ist, dass der globale
Handel vom Klimaschutz ausge-
nommen bleiben soll. Das steigert
aber massiv die Emissionen. Wir
brauchen demgegenüber eine Rück-
führung auf regionalen und lokalen
Handel. Noch mehr “Freihandel” ist
das gerade Gegenteil von Klima-
schutz.
Was haben soziale Probleme und
Menschenrechtsfragen mit Klima-
politik zu tun?
Moreno:
Ganz viel! Eine der
gröbsten und grundlegendsten
Menschenrechtsverletzungen ist
die Vertreibung von Menschen von
ihrem Land: Landraub – und das
noch dazu im Namen von „carbon
farming”. Das erzeugt Landflucht
und Flüchtlingsströme. Natürlich
brauchen wir erneuerbare Energien,
aber das muss mit einer emanzipa-
torischen Politik, mit Kooperation
und Selbstverwaltung einhergehen.
Der Schlüssel ist: Respekt vor ande-
ren Kulturen und Lebensweisen.
Welche Fragen ergeben sich zur
Finanzierung von Programmen
zum Klimaschutz und zur Anpas-
sung an den Klimawandel?
Moreno:
Geld für Klimaschutz
haben die Entwicklungsländer bis
heute keines gesehen. Die Industri-
eländer sind sehr kreativ. Sie wollen
alle in der Vergangenheit investierten
öffentlichen Entwicklungshilfegelder
als bereits bezahlte “Klimagelder”
deklarieren. Weiters versuchen
sie, den komplexen Zustand des
Ökosystems in eine einzige Formel
zu pressen: CO
2
. Damit soll ge-
handelt und bezahlt werden. Aufs
Neue wird so alles vereinheitlicht,
die Vielfalt und die Gegensätze der
Gesellschaften sind nicht abgebil-
det, bleiben unsichtbar. Das dient
nur dazu, den Kapitalismus grün zu
färben und bloß “more of the same”
zu bekommen.
Interview mit Camila Moreno
UNO-Klimakonferenz in Paris
Anfang Dezember fand in Paris die 21. UNO-Klimakonferenz, COP 21, statt.
Thema: eine neue internationale Klimaschutz-Vereinbarung in Nachfolge des
Kyoto-Protokolls. Im Vorfeld sprachen wir mit dem zivilgesellschaftlichen
Mitglied der brasilianischen Regierungsdelegation
Dr. Camila Moreno.
*Dr. Camila Moreno
ist Soziologin und u.a. Mitglied der Arbeitsgruppe
für Politische Ökologie des „Lateinamerikanischen Rates der Sozialwis-
senschaften“ (CLACSO) und nahm als zivilgesellschaftliches Mitglied der
brasilianischen Regierungsdelegation an der COP 21 in Paris teil.

















