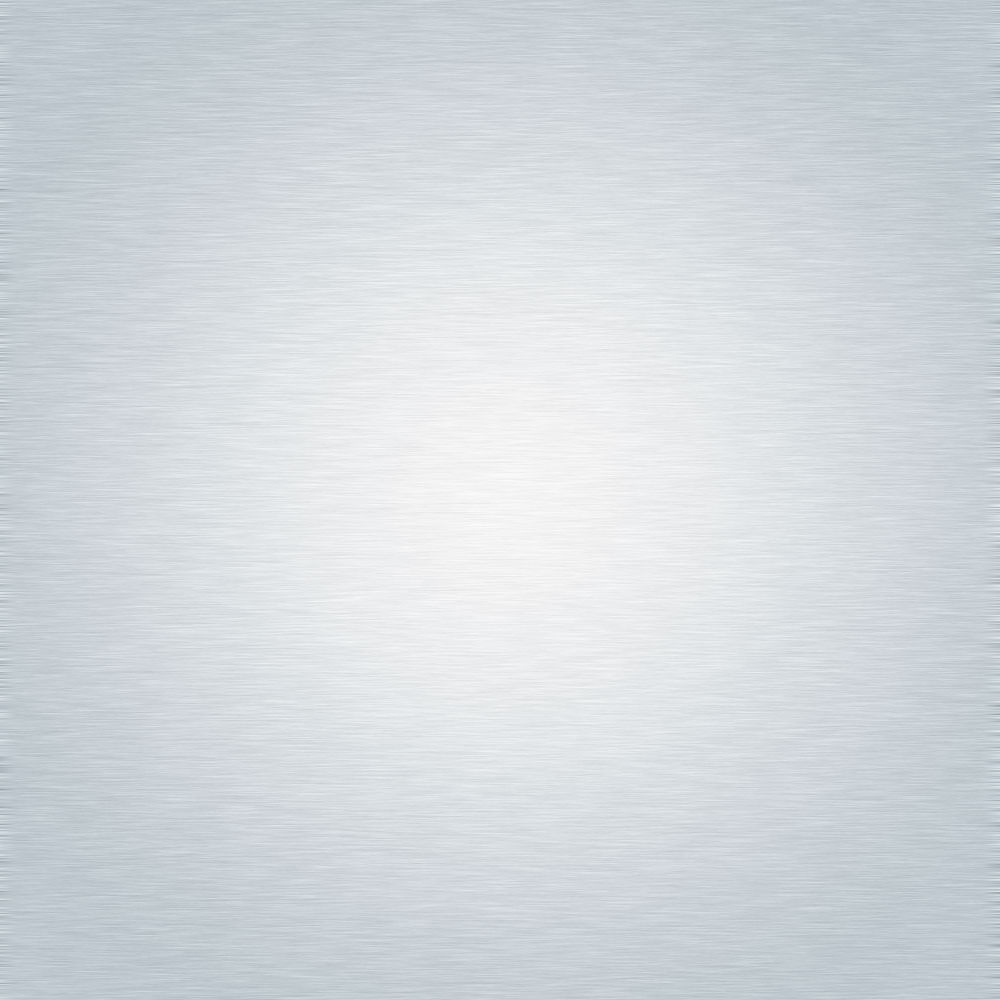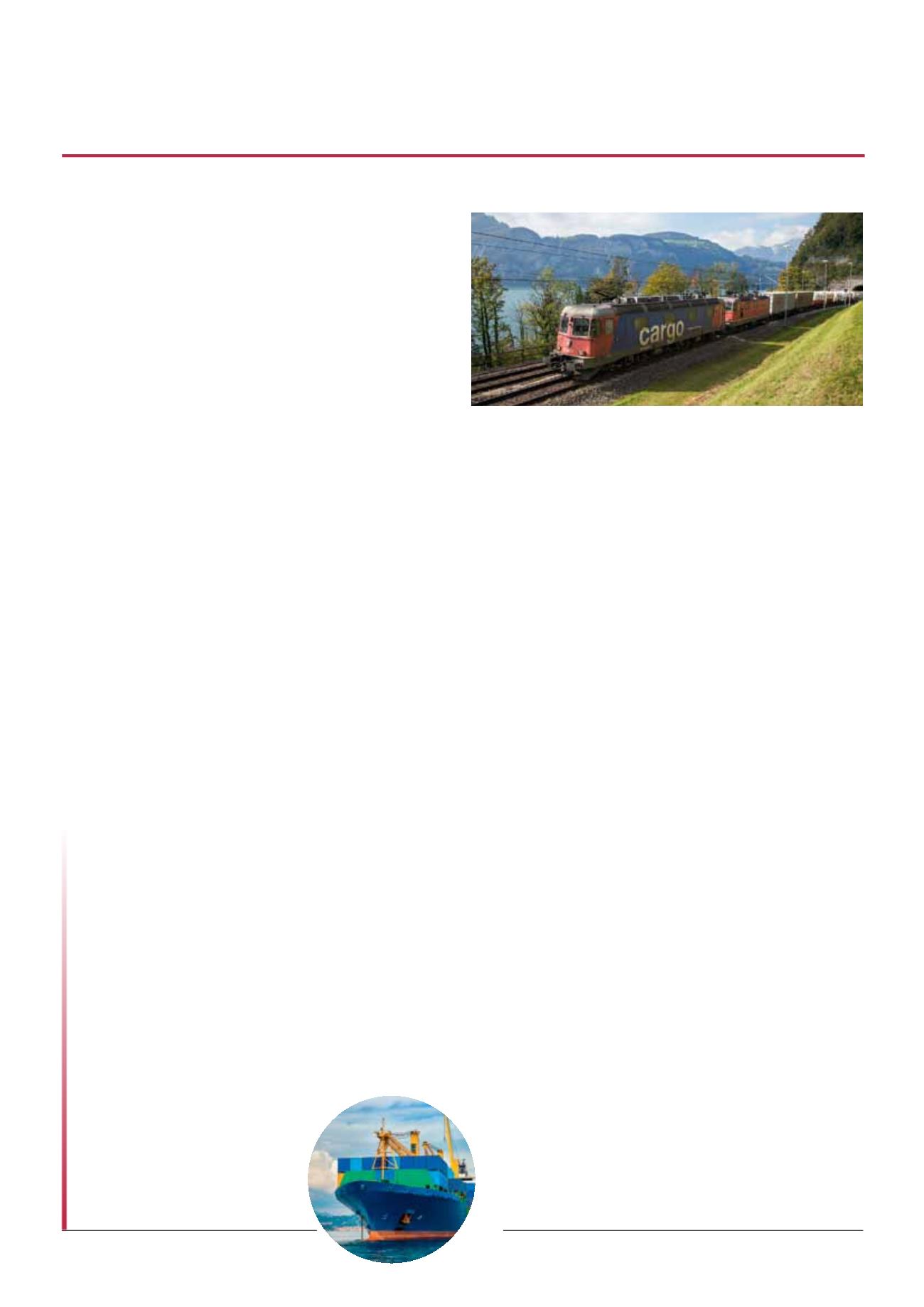
AlpenTransitverkehr
Schweiz bleibt Vorbild
Der Schweizer alpenquerende
Bahn-Güterverkehr ist enorm
gestiegen.
Laut Schweizerischem Bun-
desamt für Verkehr (BAV) ist
der Modal Split der Schiene im
alpenquerenden Güterverkehr
durch die Schweiz im ersten
Halbjahr 2016 auf ein Rekord-
hoch von 71% gestiegen. Dies
ist der höchsteWert seit 2001, als
einerseitsdie leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe (LSVA)
und andererseits die schritt-
weise Erhöhung der Gewichte
für Lkw auf 40 Tonnen eingeführt
wurden. Von insgesamt 20,8
Millionen Tonnen im Transitgü-
terverkehr wurden 14,8 Millionen
Tonnen mit der Bahn über die
Gotthard- und die Lötschberg-
Simplon-Achse transportiert (um
7,7% mehr als in der Vorjahres-
periode). Der Straßentransit ging
um 2,1% zurück. Im ersten Halb-
jahr 2016 fuhren zudem erstmals
weniger als 500.000 Lastwagen
über die Schweizer Alpen, ein
Rückgang um 3,8%. Das sei vor
allemder leistungsunabhängigen
Schwerverkehrsabgabe und der
Modernisierung der Bahn- und
Terminalinfrastruktur zu verdan-
ken, erklärt das Bundesamt.
RR
Schweiz
Feldversuch mit
Gentech-Weizen
Sechs Jahre lang darf in der
Schweiz gentechnisch ver-
änderter (GV) Winterweizen
auf ausgewählten Flächen
angebaut werden.
Das Schweizer Umweltbun-
desamt BAFU hat einen entspre-
chenden Antrag von Agroscope,
dem Kompetenzzentrum des
Schweizer Bundes für landwirt-
schaftliche Forschung, für den
Zeitraum Herbst 2016 bis Herbst
2022 bewilligt. In Zusammen-
arbeit mit dem Leibniz-Institut
für Pflanzengenetik und Kul-
turpflanzenforschung (IPK) hat
Agroscope einen GV-Winterwei-
zen entwickelt, der mehr Ertrag
bringen soll. Dafür wurde in eine
Winterweizensorte ein Gen aus
Nachrichten
AK-Positionspapiers. 43.000
Menschenmüssen wegen Lärm-
verschmutzung ins Krankenhaus
und 125 Millionen sind dauerhaft
hohem Lärm ausgesetzt. Das
macht den Lärm zum größten
Umweltproblem nach der Luft-
verschmutzung, so ein Vertreter
der EU-Kommission. Dort wird
derzeit darüber nachgedacht
wird, erste konkrete Schritte zur
Lärmreduzierung Anfang 2017
offiziell vorzuschlagen, wenn
der zweite Umsetzungsbericht
zur Umgebungslärmrichtlinie
vorgestellt wird. Diese Vor-
schläge sollten sich dabei an
den Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
orientieren.
HO
Naturkatastrophen
Pflichtversicherung?
Die Versicherungswirtschaft
fordert eine gesetzliche
Pflichtversicherung für Natur-
katastrophen.
Bei Murenabgängen wie vor
kurzem in Afritz (Stmk.) erhal-
ten die Hausbesitzer – trotz der
schweren Schäden – höchstens
10.000 Euro, berichtete
orf.at.
Eine normale Sturmversicherung
deckt imRegelfall Naturkatastro-
phen nicht. Einige Versicherer
FOTOS: SBB CFF FFS (1), iStock/ilfede (1), Schuh (1)
Seite 4
Wirtschaft & Umwelt 4/2016
Schweizer Transitgüterverkehr: zu 2/3 auf der Schiene
einer Gerste eingepflanzt, um
die Zuckerproduktion entspre-
chend zu erhöhen. Im Glashaus
wurde damit der Ertrag um 5%
gesteigert. Nun soll festgestellt
werden, ob dies auch im Freiland
zutrifft. In der Schweiz sind dafür
speziell ausgewählte Flächen
vom Bundesrat beschlossen
worden. Das Moratorium für das
Verbot zum Anbau wurde vom
Bundesrat im Juni 2016 bis 2021
verlängert und soll eine vertiefte
Diskussion über die Zukunft des
GVO-Anbaus in der Schweizer
Landwirtschaft ermöglichen.
SI
Umgebungslärm
Lärm tötet
Im EU-Parlament wurde
Anfang Oktober das Thema
Umgebungslärm behandelt.
Mindestens 10.000 Men-
schen sterben in Europa jedes
Jahr an den Folgen des Umge-
bungslärms, wie die EU Um-
weltagentur (EEA) errechnet hat.
Die EU-Umgebungslärmricht
linie, die Abhilfe schaffen soll,
gibt allerdings keine konkreten,
messbaren Ziele und verbind-
lichen Fristen für ihre Umset-
zung vor, weshalb in zu vielen
Mitgliedstaaten zu wenig getan
wird. Das ist auch die Kritik des
Maritime Schifffahrt
Niedrigere Schwefelemissionen beschlossen
Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat
am 28. Oktober 2016 einen weitreichenden Beschluss zu-
gunsten von Umwelt und Gesundheit gefasst. Demnach
muss der Schwefelgehalt in Kraftstoffen für die maritime
Schifffahrt bis 2020 von 3,5% auf 0,5% gesenkt werden.
Eine Mehrheit von Staaten verhinderte damit erfolgreich
eine Verschiebung auf das Jahr 2020, das laut deutschem
Umweltministerium rund 570.000 vorzeitige Todesfälle
nach sich gezogen hätte. Schwefelemissionen können
zu Lungenkrebs und Herzkreislauferkrankungen führen.
In der Umwelt führen sie zur Versauerung von Böden und
Gewässern. Von diesem Beschluss profitieren
vor allem küstennahe Gebiete in Asien,
Afrika und Südamerika, da für die
nordeuropäischen Gewässer sowie
die nordamerikanische Küste bereits
ein Grenzwert von 0,1% vorgeschrie-
ben ist.
FG
www.ak-umwelt.at