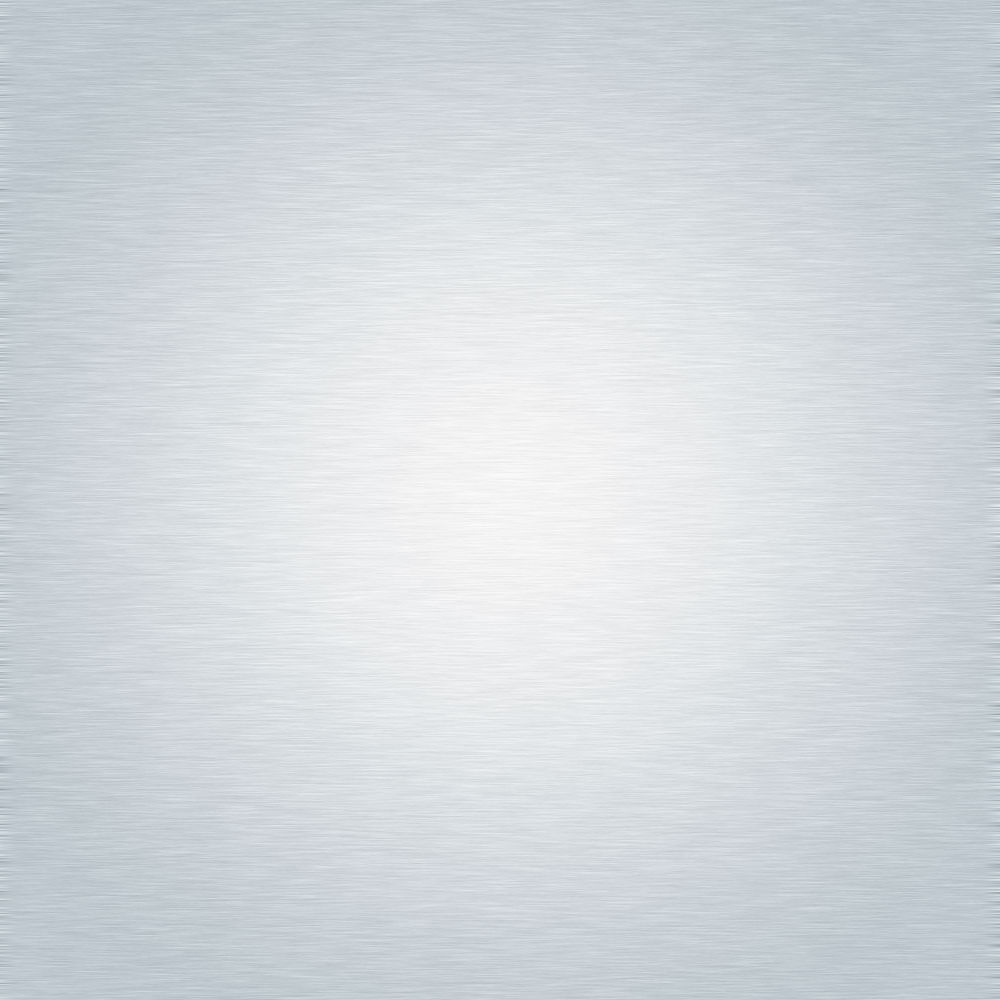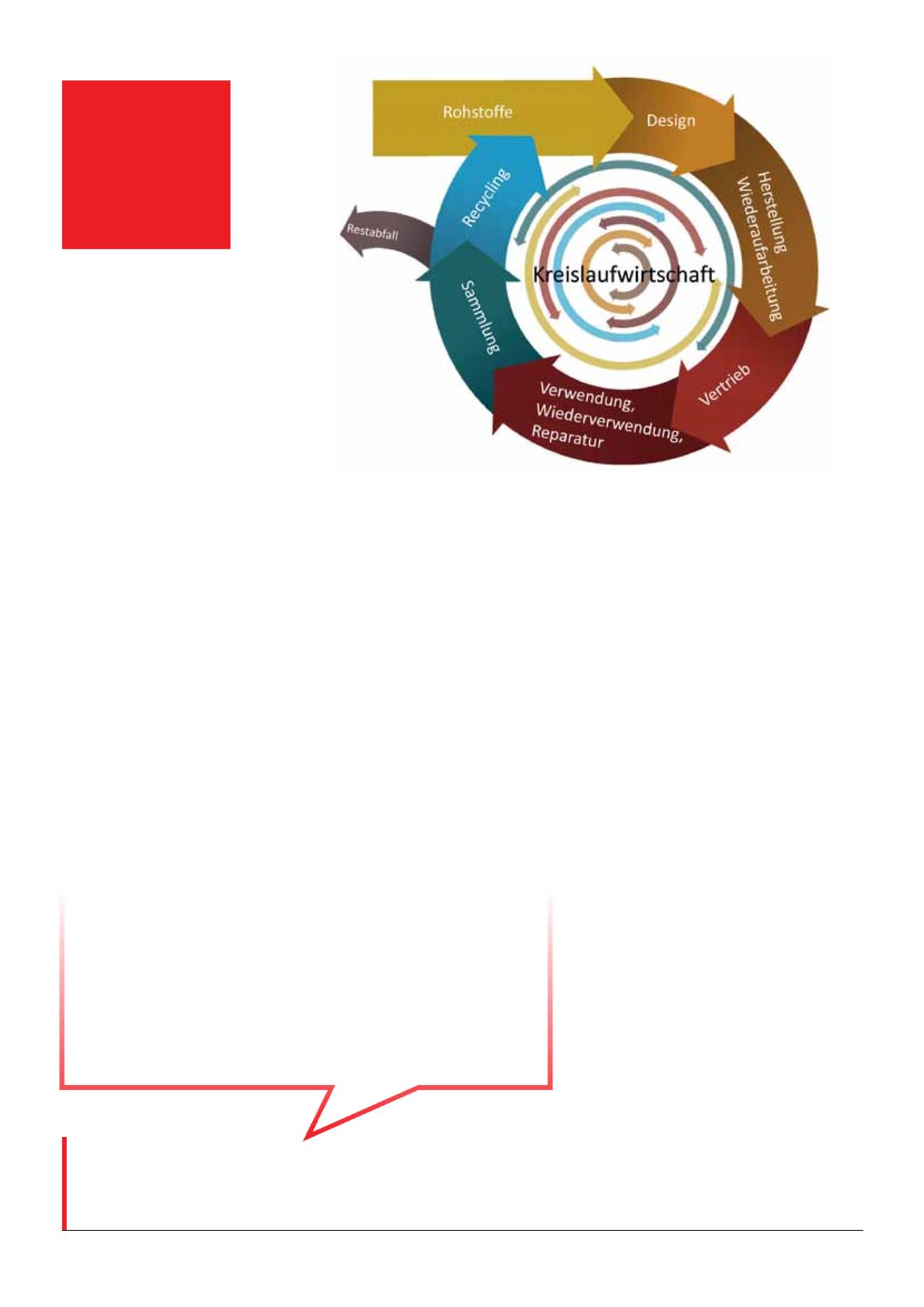
Circular statt Zero
Zu kontroversen Diskussionen führt
auch immer wieder der Begriff Kreis-
laufwirtschaft, der sehr suggestiv wie
ein Versprechen für eine bessere Welt
verwendet wird. Betrachtet man die
zum Teil widersprüchlichen Vorschläge
dazu, zeigt sich, wie wenig Aussage-
kraft dieser Begriff in Wahrheit hat und
wie leicht er auch für partikuläre Interes-
sen nutzbar gemacht werden kann. Zu
Recht hat die EU-Kommission im Rah-
men der Konsultation die Frage gestellt,
welche Produkte anhand welcher Ziele
und in welcher Phase ihres Lebenszyk-
lus – Produktion, Konsum, Abfall – mit
welchen Maßnahmen angesprochen
werden sollen.
Der Begriff Kreislaufwirtschaft oder
die Betrachtung von Stoffströmen helfen
da wenig. Kreisläufe gewährleisten nicht,
dass die mit bestimmten Produkten ver-
bundenen Umweltbelastungen entlang
ihrer Wertschöpfungskette tatsächlich,
merklich und effektiv vermindert werden.
Eine Befragung der Stakeholder anhand
der „Speisekarte der Möglichkeiten“ – so
wiediesdieKonsultationgetanhat –zeigt
nur die Interessenslagen auf. Bestes
Beispiel sind die wiederkehrenden For-
„Konsum“ finden sich Aktivitäten zum
Thema „geplante Obsoleszenz“, zu ver-
besserten Gewährleistungsregelungen
– auch im Versandhandel, zur Internali-
sierung von Umweltkosten über ökono-
mische Instrumente oder Förderung von
innovativen Formen des Gebrauchs von
Produkten.
Hohe Ambitionen
Eine umfassende Bewertung des
Pakets ist schwierig, alleine schon we-
gen seiner Vielfalt. Die Ambitionen sind
offenkundig hoch. Der Berichterstatter
im Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss hat die Verbesserungen
gegenüber dem ersten Paket gelobt und
sieht das Paket nun als gute Basis. Doch
Konkreteres ist auch aus den Schluss-
folgerungen des Rates zum Aktions-
plan, die er im Juni angenommen hat,
nicht zu entnehmen. Am ehesten wird
es z.B. Änderungen zur EU-Ecodesign-
Richtlinie geben. Ob es zu einer echten
Reform der gesetzlichen Gewährleis-
tungspflichten kommt, um eine zweites
Beispiel zu nennen, steht dagegen noch
in den Sternen. Solche Regeln würden
sofort alle Produkte erfassen, wären also
viel wirksamer als die je Produktgruppe
mühsam zu erarbeitenden Vorgaben
aufgrund der EU-Ecodesign-Richtlinie.
Es gibt derzeit keine Regeln, die die be-
rechtigte Erwartung der VerbraucherIn-
nen an die Lebensdauer von langlebigen
Produkten wie z.B. Waschmaschinen
berücksichtigen. Gerade da bestünde
Handlungsbedarf, egal ob es tatsächlich
zu einer Verlängerung der gesetzlichen
Fristen kommt, oder ob wenigstens flan-
kierende Vorgaben gemacht werden.
Hilfreich wäre es schon, wenn Hersteller
verpflichtet würden, sich verbindlich zur
Lebensdauer ihrer Produkte zu äußern.
➔
*
Unser Standpunkt
Den schönen Worten Taten folgen lassen
¢
Solide Entscheidungsgrundlagen
¢
Eine unabhängige KonsumentInneninformation schaffen
¢
KonsumentInnen in Dialogplattformen einbeziehen
¢
Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Produkten
wirksam fördern
Schwerpunkt
Kreislauf-
wirtschaft
www.ak-umwelt.atSeite 12
Wirtschaft & Umwelt 4/2016
Quelle: EUROPÄISCHE KOMMISSION, COM(2014) 398 final, Seite 6