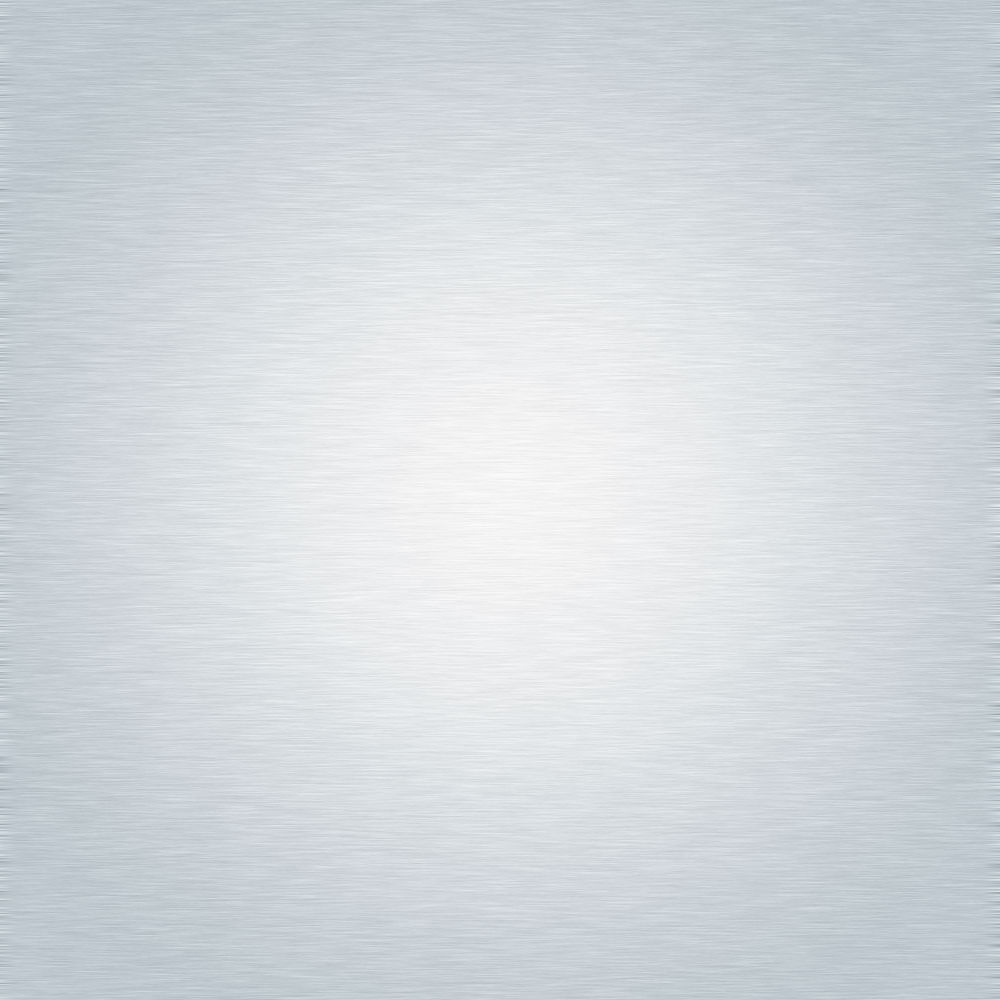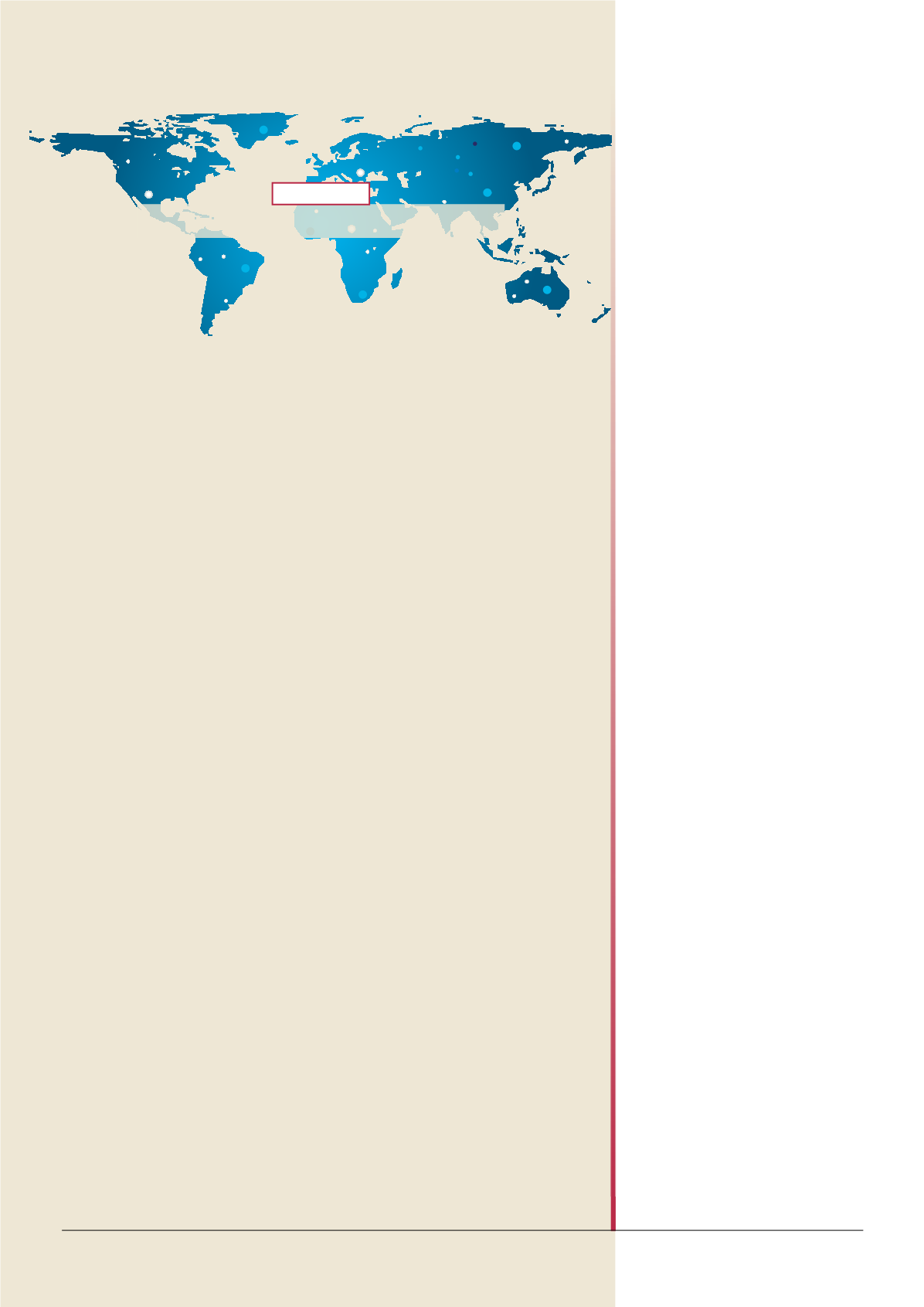
FOTOS: Schuh (1)
www.ak-umwelt.atSeite 6
Wirtschaft & Umwelt 4/2016
Nachrichten
„nichtfinanzielle Erklärung“
zu prüfen. Da werden auch
Betriebsräte in die Diskussion
einbezogen sein. Positiv ist
auch, dass die Erläuterungen
konkrete Arbeitnehmerbelange
nennen und extra klarstellen,
dass eine Berichterstattung
anhand der Variante G4 der
Global Reporting Initiative (GRI)
jedenfalls ausreichend sein
wird. Die Richtlinie 2014/95/EU
regelt stärkere Anforderungen
an die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung von großen Unter-
nehmen als bisher und muss
Anfang Dezember umgesetzt
sein. Ansonsten bleibt der Ent-
wurf hinter vielen Vorschlägen
zurück, die im Zuge der Kon-
sultation vorgebracht wurden,
und wiederholt nur den Wortlaut
der Richtlinie, ohne ihn weiter
zu konkretisieren. Sehr wün-
schenswert wäre, wenn auch
große öffentliche Unternehmen
wie ASFINAG, ÖBB oder der
Verbund einbezogen wären und
Wirtschaftsprüfer die Erklärung
auch inhaltlich zu überprüfen
hätten.
HO
Österreich
Nitrat im Grundwasser
Beschwerde an die EU Kom-
mission.
Der Burgenländische Was-
serleitungsverband brachte eine
Beschwerde bei der EU-Kom-
mission ein. Der Grund ist die
mangelhafte Umsetzung der EU-
Nitratrichtlinie in Österreich. Die
EU-Nitratrichtlinie verfolgt das
Ziel, die Verschmutzung der Ge-
wässer durch Nitrat zum Schutz
der menschlichen Gesundheit zu
reduzieren sowie einer weiteren
Verunreinigung vorzubeugen.
Trotz ausgewiesener Schutz-
und Schongebiete kommt es bei
einigen Wasserversorgungsan-
lagen regelmäßig zu massiven
Nitratbelastungen, weit über
dem erlaubten Wert von 50
CO
2
-Emissionen des
internationalen Schiffs-
verkehrs:
Die Internationale See-
schifffahrts-Organisation
(IMO) hat die Einbezie-
hung der CO
2
-Emissionen
von Schiffen im internatio-
nalen Transport wieder für
zumindest sieben Jahre
hinausgeschoben, kritisiert
die NGO Transport and
Environment. Statt konkre-
te Schritte zur Emissions-
reduktion zu setzen, wie
es zur Umsetzung des
Klimaabkommens von
Paris dringend nötig sei,
hätte das zuständige
Komitee der IMO nur ein
neues System der
Datensammlung über den
Treibstoffverbrauch von
Schiffen ins Leben
gerufen.
Nachhaltiger Anbau von
Ölpalmen:
Zehn afrikanische Staaten
– Kamerun, Elfenbeinküs-
te, die Demokratische
Republik Kongo, die
Republik Kongo, Gabun,
Ghana, Liberia, Nigeria,
Sierra Leone und die
Zentralafrikanische
Republik – haben im Zuge
der 22. Klimakonferenz in
Marrakesh (Marokko) eine
Deklaration für die
nachhaltige Entwicklung
des Palmölsektors
verabschiedet. Die
Staaten anerkennen, dass
dem tropischen Regen-
wald eine zentrale Rolle
beim Klimaschutz
zukommt. Sie wollen die
Fehler von Malaysia und
Indonesien vermeiden, wo
große Flächen an Regen-
wald gerodet wurden, um
Ölpalmen-Plantagen Platz
zu machen. Der Anbau der
Ölpalmen soll daher netto
zu keiner Entwaldung
führen. Weitere Prinzipien
der Erklärung sind die
gerechte Aufteilung der
Nutzen, gute Arbeitsbe-
dingungen und die
Berücksichtigung der
Bedürfnisse indigener
Gruppen. Siehe: www.
tfa2020.org/activities/african-palm-oil-initiative
Aus für Plastikbesteck:
Am 1. Jänner 2017 tritt in
Frankreich das Verbot von
Einweg-Plastiksackerln in
Kraft. Nun wurde ein
weiteres Verbot erlassen,
welches 2020 in Kraft
treten soll: Ab dann dürfen
Plastikbecher und
Plastikteller nur mehr in
Verkehr gesetzt werden,
wenn ihr Anteil an Kunst-
stoffen aus nachwachsen-
den Quellen („Biokunst-
stoff“) mindestens 50
Prozent beträgt. Die
Maßnahme ist Teil des
Gesetzes „Energiewende
für grünes Wachstum“, das
von der französischen
Umweltministerin Ségolène
Royal vorangetrieben wird.
Widerstand gegen die
Maßnahme kommt von
Pack2GoEurope, dem Inte-
ressensverband der
Lebensmittel-Verpa-
ckungsindustrie.
Artenschutz:
Anfang Oktober fand in
Johannesburg (Südafrika)
die 17. Vertragsstaaten-
konferenz des Washingto-
ner Artenschutzüberein-
kommens statt, auch
bekannt unter ihrer
englischen Abkürzung
CITES. Wieder wurde eine
große Zahl wildlebender
Tierarten, aber auch einige
Pflanzen in die Listen der
Arten aufgenommen, die
nicht oder nur einge-
schränkt gehandelt werden
dürfen. Ein Thema, dem
viel Raum gewidmet
wurde, war der Handel
mit Elfenbein. Grundsätz-
lich ist der zwischenstaatli-
che Handel mit Elfenbein
nach CITES derzeit
verboten, ausgenommen
gelegentlich erlaubte
Versteigerungen. Eine
Studie hatte aber ergeben,
dass diese zu einer
Zunahme der Nachfrage
und somit zum Anstieg der
Zahl an Abschüssen von
Elefanten durch Wilderer
geführt hätten. Die
Vertragsstaaten stimmten
schließlich gegen den
Antrag einiger afrikanischer
Staaten, einen kontrollier-
ten Handel mit Elfenbein
zuzulassen.
CS
EU, Europa und die Ganze Welt
Auf einen Blick