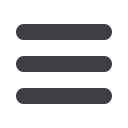
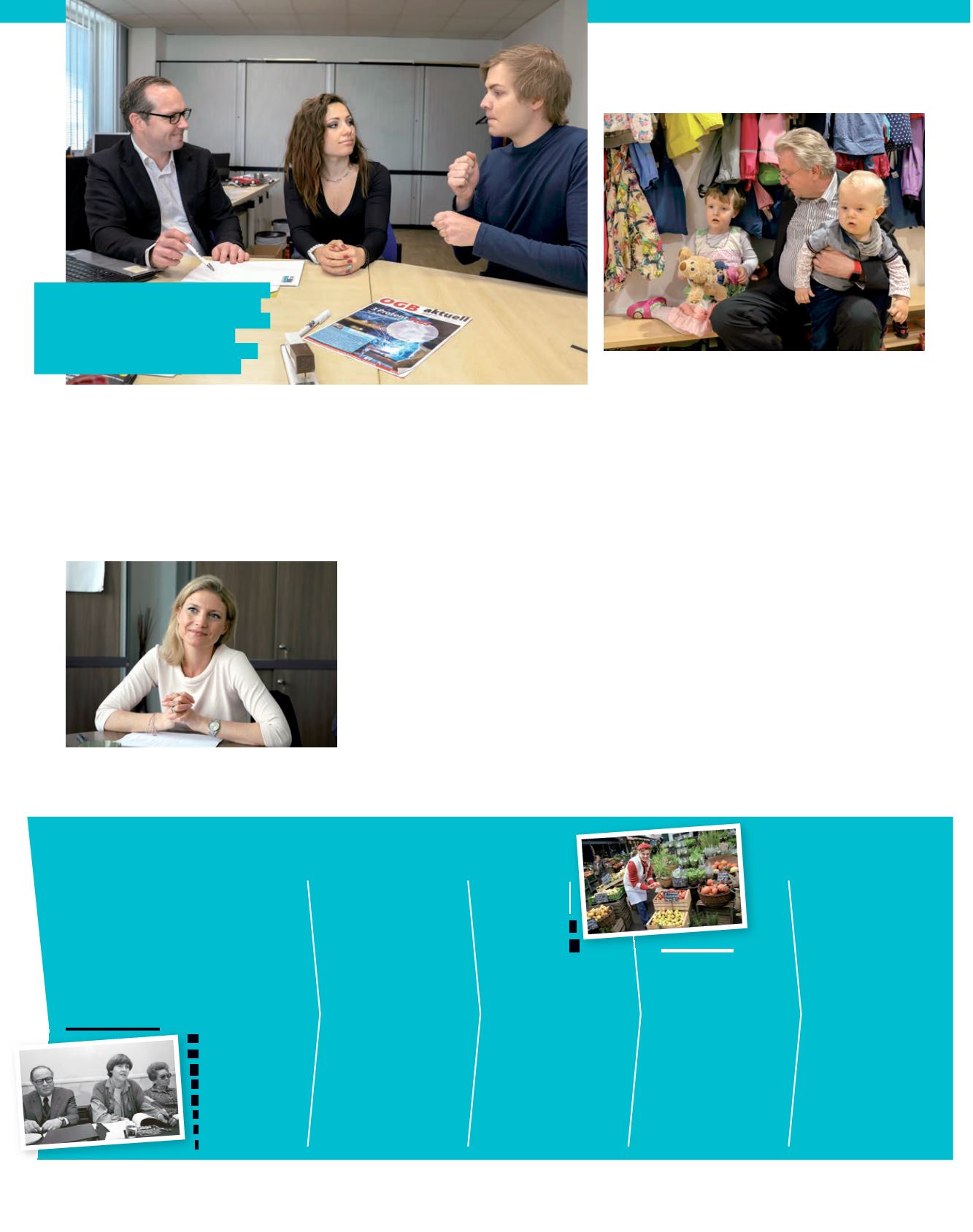
10
AK FÜR SIE 05/2018
hergibt“. Sie ist überzeugt: „Sonst kann be-
ruflich nichts weitergehen.“ Auch während
der Karenz sollten Frauen wie Männer sich
melden: „Und zwar nicht nur mit süßen Ba-
byfotos bei den Kolleginnen, sondern auch
mit beruflichen Themen beim Vorgesetzen.“
Herwig Wöhs bringt seine dreieinhalb
Jahre alte Tochter Franziska und seinen
eineinhalb Jahre alten Sohn Anton jeden
Morgen in den Betriebskindergarten. Bei
beiden Kindern hat er sich entschieden,
auch in Karenz zu gehen. „Für meinen Ar-
beitgeber war das überhaupt kein Prob-
lem. Wir haben gemeinsam nach einer
guten Lösung für diese Zeit gesucht.“ Die
„Väterbeteiligung“ bei der Allianz kann sich
sehen lassen: Von rund 70 MitarbeiterIn-
nen, die jedes Jahr in Karenz gehen, sind
ein Fünftel Männer.
Der Kollektivvertrag wirkt
Melanie Strobl arbeitet bei Siemens als
Elektrikerin. Sie interessiert sich sichtlich
für Mode und hat auch versucht, im Ver-
kauf zu arbeiten. Aber sie habe dann doch
lieber etwas Handwerkliches machen wol-
len, übersetzt ihr Kollege Markus Österrei-
cher aus der Gebärdensprache. Die junge
Frau sieht sich interessiert den sogenann-
ten Einkommensbericht an. Wie liegt sie
im Vergleich zu den Kollegen? Sie ist zu-
frieden mit ihrem Lohn. „Bei uns wirkt der
Kollektivvertrag gut“, sagt der Betriebsrat
Roland Feistritzer. Er wird im Mai Papa
und will sich Zeit für sein Baby nehmen.
Als Betriebsrat achtet er außerdem auf
Gleichberechtigung im gesamten Betrieb,
insbesondere bei Lohn und Gehalt. Dazu
gibt es den Einkommensbericht, einen an-
onymen Vergleich der durchschnittlichen
Einkommen von Frauen und Männern im
Unternehmen, die die gleiche Arbeit ma-
chen. Roland Feistritzer sagt: „Es erkundi-
gen sich immer mehr. Wenn wir wo deutli-
che Unterschiede entdecken, führen wir
ein Gespräch mit dem Vorgesetzten der
Kollegin – und der arbeitet dann daran,
dass sich das Einkommen in die richtige
Richtung entwickelt.“
■
MARIANNE LACKNER,
KATHARINA ALLAHYARI-NAGELE
Siemens-Betriebsrat Roland Feistritzer
zeigt der Elektrikerin Melanie Strobl,
wie ihr Gehalt im Vergleich zum Durch-
schnitt der Kollegen liegt. Sie ist
zufrieden, übersetzt Kollege Markus
Österreicher die Gebärdensprache
Herwig Wöhs bringt Franziska und Anton jeden Tag
in den Allianz-Betriebskindergarten
Stephanie Hafner von der Allianz-Versiche-
rung weiß ihre Schulkinder im betriebseige-
nen Kids Klub gut betreut
Kampf um gerechte Einkommen
1979:
Gleichbehandlungsgesetz
für die Privatwirtschaft,
Streichung von Frauenlöhnen.
Die
Pflicht zur Gleichbehandlung von Männern
und Frauen bei der Festsetzung des Entgelts
wurde gesetzlich festgeschrieben, die letzten
„Frauenlohngruppen“ aus den Kollektivver-
trägen gestrichen.
Johanna Dohnal
und Ministerin
Hertha Firnberg (r.)
und Bundeskanz-
ler Bruno Kreisky
im Palais Dietrich-
stein in Wien.
1979
Foto:
picturedesk.com/
Imagno / Votava
1993:
Anrech-
nung
von Karenzzeiten.
Elternkarenz wird im
Ausmaß von zehn
Monaten für Urlaub,
Entgeltfortzahlung und
Kündigungsfrist ange-
rechnet (Maßnahme ist
Teil des Gleichbehand-
lungspakets).
2008:
Mehrarbeits-
zuschläge für
Teilzeitarbeit.
Durch
eine Novelle zum
Arbeitszeitgesetz
erhalten Teilzeitbeschäf-
tigte, wenn sie Mehr-
arbeit leisten müssen,
einen Zuschlag in der
Höhe von 25 Prozent.
2011:
Verpflichtende
Einkommensberich-
te.
Eine Novelle zum
Gleichbehandlungsge-
setz bringt die gesetz-
liche Verankerung von
innerbetrieblichen Ein-
kommensberichten.
2017:
1.500
Euro
Mindestlohn.
In einer
Generalvereinbarung
einigen sich die Sozial-
partner auf einen
Mindestlohn von 1.500
Euro brutto für alle.
Die Umsetzung muss
bis 2020 auf Kollektiv-
vertragsebene erfolgen,
wo immer der
niedrigste Einstiegslohn
noch darunter ist.
Verkäuferin am Wiener
Naschmarkt
Foto: picturedesk.com / Robert Newald


















