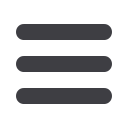
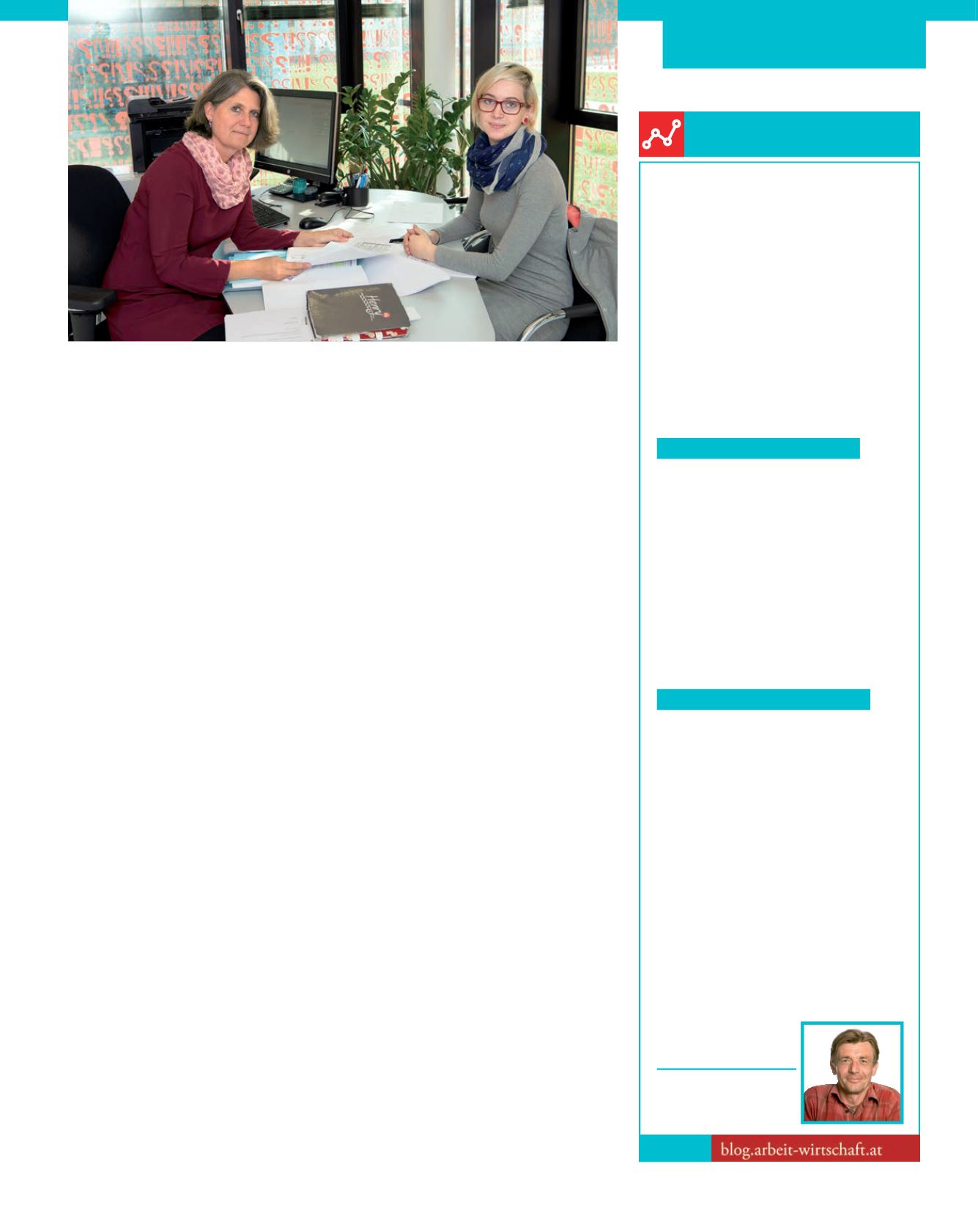
im Blick
AK Juristin Julia Vazny-König (links) berät eine ehemalige Mitarbeiterin von „Henry am Zug“,
die gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen Klage eingebracht hat
Foto: Erwin Schuh
I
m Oktober stand am Wiener Arbeits-
und Sozialgericht das System „Henry
am Zug“ erneut vor Gericht. Den Mitar-
beiterInnen des Unternehmens, das für die
Verpflegung der ÖBB-Fahrgäste im Zug
sorgt, wurden Pausen und Ruhezeiten vor-
enthalten. „Da bleibt nur das Klo. Manche
haben dort gegessen, nur dort hatte man
seine Ruhe“, so eine ehemalige Arbeitneh-
merin, die mithilfe der AK geklagt hat.
Für manche ist es nie genug!
Das Arbeitsinspektorat deckte 2016 die
Verstöße auf: Die MitarbeiterInnen muss-
ten teils bis zu 17 Stunden am Stück
schuften. Die höchste zulässige Tagesar-
beitszeit liegt laut Gastgewerbe-Kollektiv-
vertrag, der für „Henry am Zug“ bis 30.
Juni galt, bei zwölf Stunden.
Der Fall „Henry am Zug“ zeigt, wie
wichtig eine Beschränkung der Arbeits-
zeit ist: „Für manche ist es eben nie ge-
nug“, sagt AK Direktor Christoph Klein.
„Hier sagen wir als AK klar: Stopp! Diese
Regelungen sind flexibel genug.“ Kämp-
fen zahlt sich jedenfalls aus: Dank der
Gewerkschaft vida gibt es jetzt einen
neuen Kollektivvertrag für die gastronomi-
sche Betreuung auf Schienenbahnen mit
20 Prozent mehr Lohn.
■
K.N.A.
17 Stunden am Stück
Bei „Henry am Zug“ mussten die MitarbeiterInnen bis zu
17 Stunden am Stück arbeiten. Sie klagten mithilfe der AK.
F
ür 97 Prozent aller ArbeitnehmerInnen
in Österreich gilt ein Kollektivvertrag.
Das sichert ein hohes Lohnniveau.
Und das ist nicht nur für die Arbeitneh-
merInnen gut. Die Wettbewerbsfähigkeit
der gesamten Wirtschaft profitiert ebenfalls,
auch wenn das auf den ersten Blick para-
dox erscheint.
Billige Arbeit, wenig Technologie
Aber schon auf den zweiten Blick erkennt
man, dass so genannte Billiglohnländer viel
weniger Spitzentechnologie hervorbringen.
Sie übernehmen meistens nur Technologien,
die in anderen Ländern entwickelt wurden.
Die meisten Menschen müssen unter oft
menschenunwürdigen Bedingungen in Fabri-
ken Konsumgüter zusammenbauen. Doch
die Maschinen, an denen sie arbeiten,
kommen aus den Hochlohnländern im
Westen.
Wettbewerb nicht über Lohndruck
Eine ähnliche Wirkung tritt ein, wenn für
weniger ArbeitnehmerInnen ein Kollektivver-
trag gilt. Weniger produktive Betriebe
derselben Branche versuchen dann ihre
Wettbewerbsnachteile auf die Arbeitneh-
merInnen durch niedrigere Löhne abzuwälzen.
Das hemmt die wirtschaftliche Entwicklung
der gesamten Volkswirtschaft. Die Arbeitneh-
merInnen können sich nicht mehr darauf
verlassen, dass sie für dieselbe Qualifikation
auch bei einem anderen Unternehmen den
gleichen Lohn bekommen. Hohe Löhne
hingegen erhöhen den Anreiz, in Technologie
zu investieren. Und sie machen menschliche
Arbeitskraft zu einem kostbaren Gut, die nicht
in „Sweat Shops“ mit unmenschlichen
Arbeitsbedingungen
verschlissen wird.
Technologie dank
höherer Löhne
Wirtschaft
klipp&klar
Gernot Mitter
AK Abteilung Arbeitsmarkt und
Integration
Mehr auf
10
AK FÜR SIE 11/2017
430.000 Euro weniger für Frauen?
Frauen verlieren durch die Einkommensschere ein Leben lang.
Hausarbeit und Altenpflege zu leisten,
verringern Frauen oft ihre Erwerbsarbeits-
zeit. Ein unzureichendes Angebot an Kin-
derbildung und -betreuung und zu wenig
partnerschaftliche Arbeitsteilung drängen
Frauen in die Teilzeitfalle. Dabei arbeiten
sie insgesamt mehr: 65 Stunden pro Wo-
che arbeiten erwerbstätige Frauen im
Durchschnitt bezahlt und unbezahlt, Män-
ner 63 Stunden. Die AK fordert, dass die
Einkommensschere endlich geschlossen
wird! Dazu muss es mehr Betreuungs-
plätze geben und mehr Lohntransparenz
in den Betrieben.
■
K.N.A.
D
ie Einkommensnachteile von
Frauen gegenüber Männern sum-
mieren sich in Österreich über ein
ganzes Erwerbsleben von durchschnitt-
lich 34,5 Jahren auf unrühmliche 435.000
Euro. Das hat die Arbeiterkammer auf
Basis der EU-weiten Verdienststruktur-
erhebung berechnet.
Nachteile auf mehreren Ebenen.
Beim Einkommen haben Frauen auf meh-
reren Ebenen Nachteile gegenüber Män-
nern: „Typische Frauenberufe“ werden
schlechter bezahlt. Um Kinderbetreuung,


















