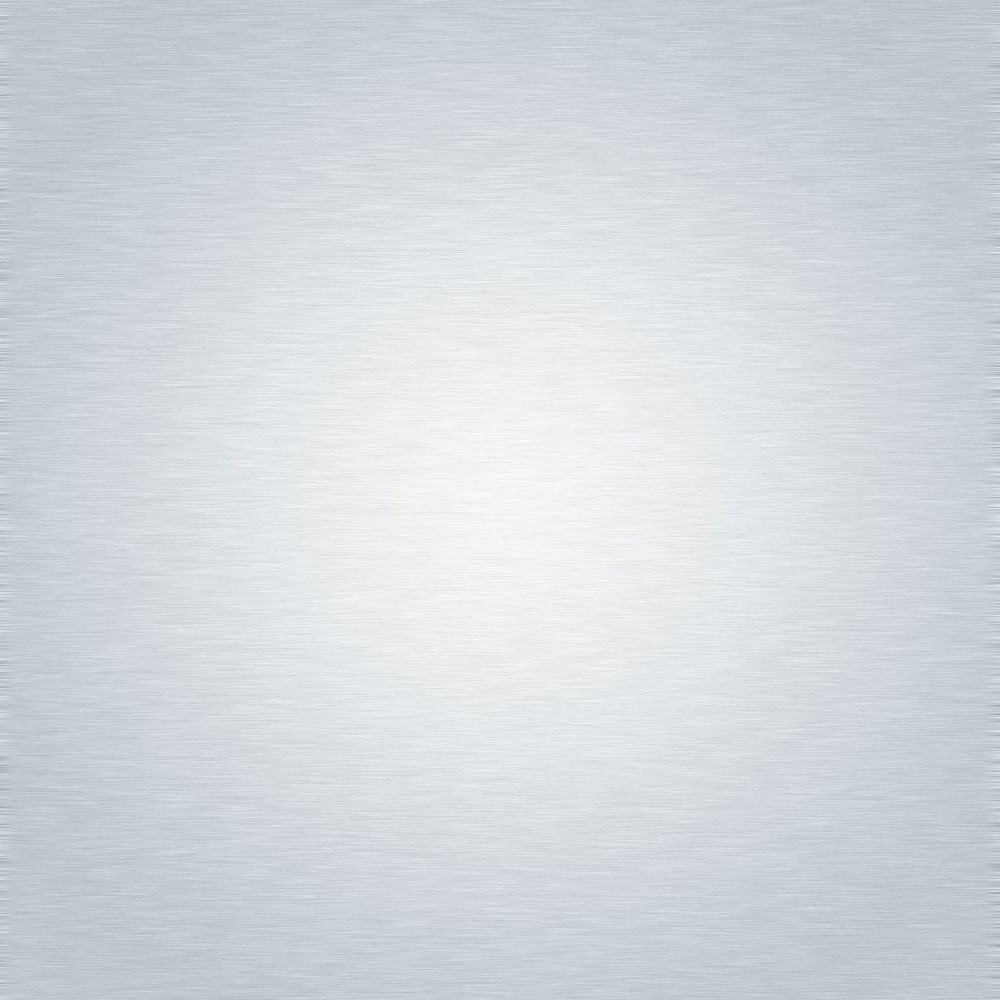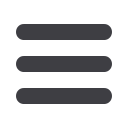
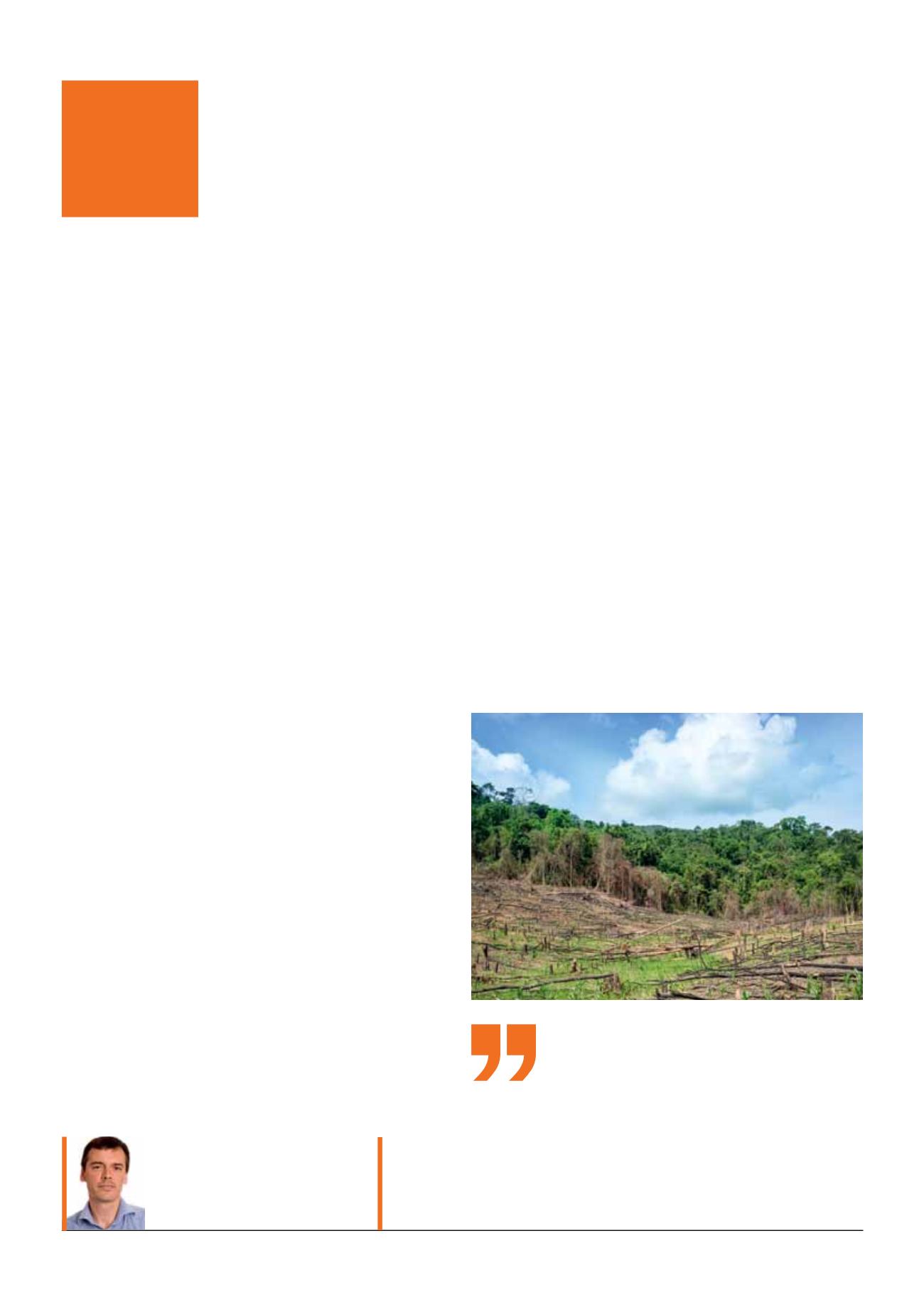 www.ak-umwelt.at
www.ak-umwelt.at
Seite 28
Wirtschaft & Umwelt 1/2016
Z
unächst sei die Ausgangssi-
tuation kurz zusammenge-
fasst: Das Kyoto-Protokoll aus
1997 legte für die Verringerung
des Ausstoßes an Treibhaus-
gasen Ziele fest, die die Indus-
triestaaten im Zeitraum 2008
bis 2012 erreichen sollten. Die
Entwicklungsländer hatten zwar
gewisse allgemein formulier-
te Verpflichtungen, aber keine
mengenmäßigen Emissions-
beschränkungen. Im Jahr 2009
wurde daher versucht, bei der
Klimakonferenz in Kopenhagen
ein Nachfolge-Abkommen für
das Kyoto-Protokoll zu beschlie-
ßen. Dieses sollte sicherstellen,
dass nach Ablauf der ersten Pha-
se des Kyoto-Protokolls, also ab
2013, eine zweite Periode mit
Verpflichtungen anschließt, die
die Entwicklungsländer mit ein-
beziehen.
Doch dieses Vorhaben schei-
terte – zu unterschiedlich waren
die Interessen der verschiede-
nen Fraktionen von Staaten. Der
Minimalkompromiss bestand
darin, eine unverbindliche Er-
klärung zu verabschieden, die
bloß festhielt, dass die globale
Erwärmung zwei Grad Celsius
nicht überschreiten solle. Es
wurde kein weiterer Versuch
gemacht, für die Zeit ab 2013
bindende Klimaziele festzule-
gen. Stattdessen einigten sich
die Vertragsstaaten darauf, bis
2015 einen neuen Vertrag aus-
zuarbeiten, der 2020 in Kraft
treten sollte. Damit wurde der
Ausarbeitung des Textes viel Zeit
gegeben – vermutlich ein Schritt,
der wesentlich zum letztendli-
chen Erfolg der Konferenz in
Paris beitrug.
Wer im Pariser Abkommen
klare Verpflichtungen der Ver-
tragsstaaten zur weiteren Ver-
ringerung der Emissionen sucht,
wird freilich nicht fündig. Die Ver-
tragsstaaten legen selbst fest,
welche Ziele im Klimaschutz sie
*Dr. Christoph Streissler
ist
Chemiker und Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Verkehr
der AK Wien.
Der vorliegende Beitrag erschien in etwas kürzerer
Fassung im A&W Blog am 21.12.2015.
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/?s=21.+12.+2015
Klimaabkommen von Paris:
Mehr Licht als Schatten
Am 12. Dezember des vergangenen Jahres ging in Paris die 21. Ver-
tragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention, kurz COP 21,
zu Ende. Die Erwartungen an diese Klimakonferenz waren im Vor-
feld immer stärker in die Höhe geschraubt worden. Wie weit war die
Konferenz ein Erfolg, was bleibt noch zu tun?
Von Christoph Streissler*
Politik
Kurzgefasst
In Paris wurde im ver-
gangenen Dezember
ein Klima-Abkommen
beschlossen, das die
Basis für eine Beschrän-
kung der globalen Erwär-
mung auf unter zwei
Grad Celsius legen soll.
Das Abkommen ist ein
Fundament. Darauf muss
nun – recht rasch – ein
dauerhaftes Gebäude
entstehen.
Erstmals verpflichten sich auch
die Entwicklungsländer zu mengen-
mäSSigen Zielen beim Klimaschutz.
Fotos: Schuh (1), istock/fazoni1 (1), istock/kirham (1)