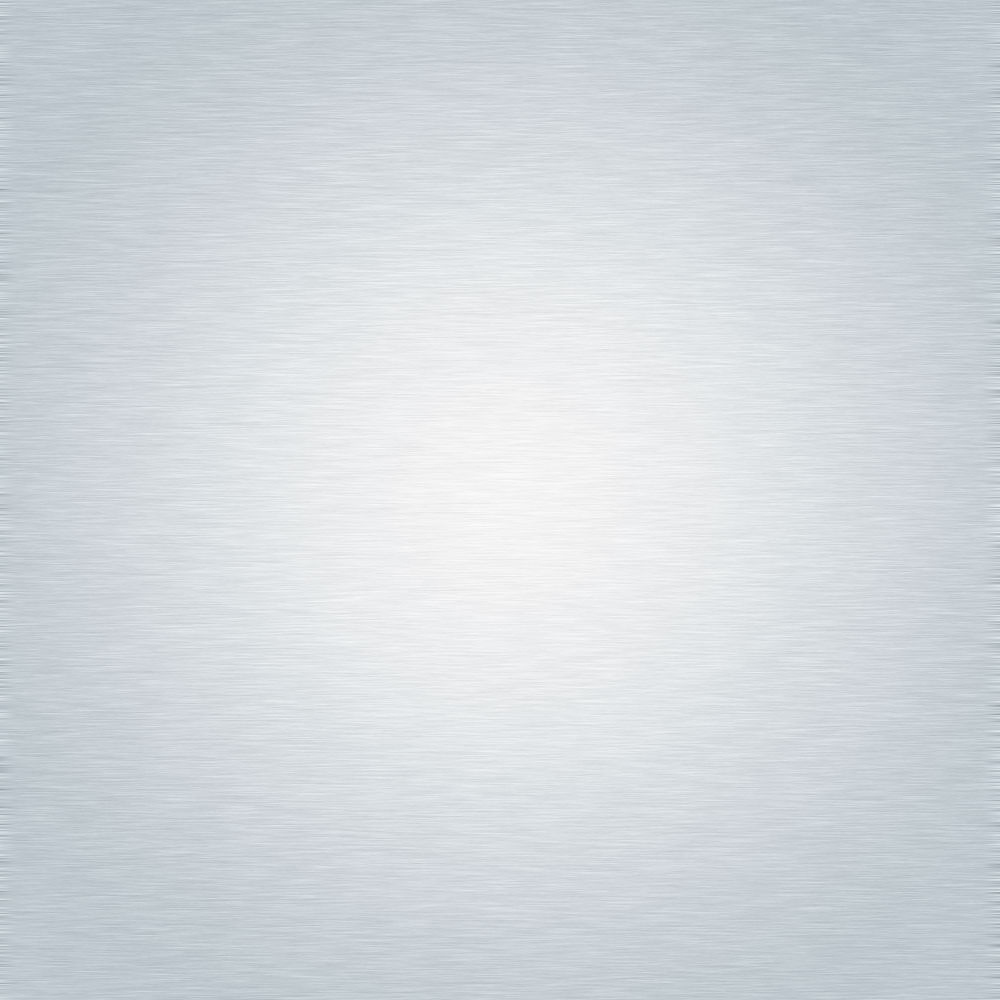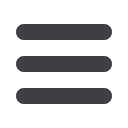

viduellen Gesundheit und Vulnerabilität
sollen in einen Zusammenhang mit der
Exposition amWohnort (bspw. Luftquali-
tät, Lärmbelastung) gebracht werden. In
diesem Sinne werden in Modellregionen
unter demBegriff „Umweltgerechtigkeit“
bereits systematisch Daten zu raumbe-
zogenen Gesundheitsbelastungen mit
Daten zum sozio-ökonomischen Status
– wie Einkommen und Bildung – ver-
knüpft (siehe Kasten Seite 13).
Ungleich oder ungerecht?
Im Lichte der Umweltgerechtigkeits-
diskussion sollen gesundheitsschäd-
liche Umweltbelastungen möglichst
verhindert oder gemindert werden, un-
vermeidbare Belastungen sind „gerecht“
zu verteilen. Zumindest hier drängt sich
jedoch die Frage auf, wie Gerechtigkeit
zu beurteilen ist? Ist in Gesundheitsfra-
gen Ungleichheit gleichbedeutend mit
Ungerechtigkeit? Würde die Einhaltung
von Mindeststandards bereits für ein
höheres Maß an Gerechtigkeit sorgen?
Wer trägt die Kosten für die Beseitigung
oder Minderung der Umweltbelastung?
Reicht es aus, wenn die Betroffenen an
der Entscheidungsfindung beteiligt sind
oder über Wahlmöglichkeiten verfügen?
erweitert. Da für die USA Umwelt-
und Sozialdaten kleinräumig verfügbar
sind, lässt sich beispielsweise zeigen,
dass Schwarze in ihrer Wohnumgebung
überproportional mit Luftschadstoffen
der Industrie belastet sind. Mittlerweile
liegen derartige Analysen für zahlreiche
soziale und ethnische Gruppen, konkre-
te Belastungen – bis zu kontaminierten
Lebensmitteln – sowie unterschiedliche
Betrachtungsräume vor. In den späten
1990er Jahren hat die Diskussion zu
umweltbezogener Gerechtigkeit über
Großbritannien schließlich den Weg
nach Europa gefunden. Insbesonde-
re die schottische Labour-Regierung
nahm sich während ihrer Regierungszeit
von 1999-2005 – in enger Kooperation
mit der Umwelt-NGO „Friends of the
Earth“ und unter Einbindung wissen-
schaftlicher Expertise – des Problems
schichtspezifischer Umweltbelastun-
gen an. Für westeuropäische Verhält-
nisse waren die Problemlagen – u.a.
Varianz der Lebenserwartung, Energie-
armut – dort auch besonders massiv. In
Deutschland werden die Zusammen-
hänge zwischen Umweltqualität, sozi-
aler Ungleichheit und Gesundheit seit
der Jahrtausendwende wieder stärker
thematisiert. Während sich die Diskus-
sionen in den einschlägigen sozial- und
gesundheitswissenschaftlichen Diszi-
plinen lange um Umwelteinstellungen
und individuelles Gesundheitsverhalten
drehten, werden Umweltaspekte wie-
der stärker als entscheidende Faktoren
von ‚health inequality‘ wahrgenommen.
Zunehmend widmen sich wissenschaft-
liche Publikationen und Tagungen den
klassischen Themen der öffentlichen
Gesundheitsvorsorge wie den Auswir-
kungen ungesunder Wohnumgebungen
auf Asthma, Allergien oder stressbe-
dingte Erkrankungen. Fragen der indi-
➔
*
Unser Standpunkt
Umweltbezogene Gerechtigkeit erfordert
¢
Chancengleichheit bei umweltbezogenen Gesundheits-
fragen und Mitspracherechte bei der Gestaltung der
persönlichen Lebensumwelt
¢
Berücksichtigung von Verteilungsaspekten in der Klima-
politik
¢
Förderung klimafreundlicher und leistbarer Mobilitäts-
und Wohnformen
Klimaziele: Sind Verteilungskonflikte unvermeidbar?
Schwerpunkt
Umwelt und
Verteilungs
gerechtigkeit
www.ak-umwelt.atSeite 12
Wirtschaft & Umwelt 3/2016
FOTOS: iStock/rrodrickbeiler (1)