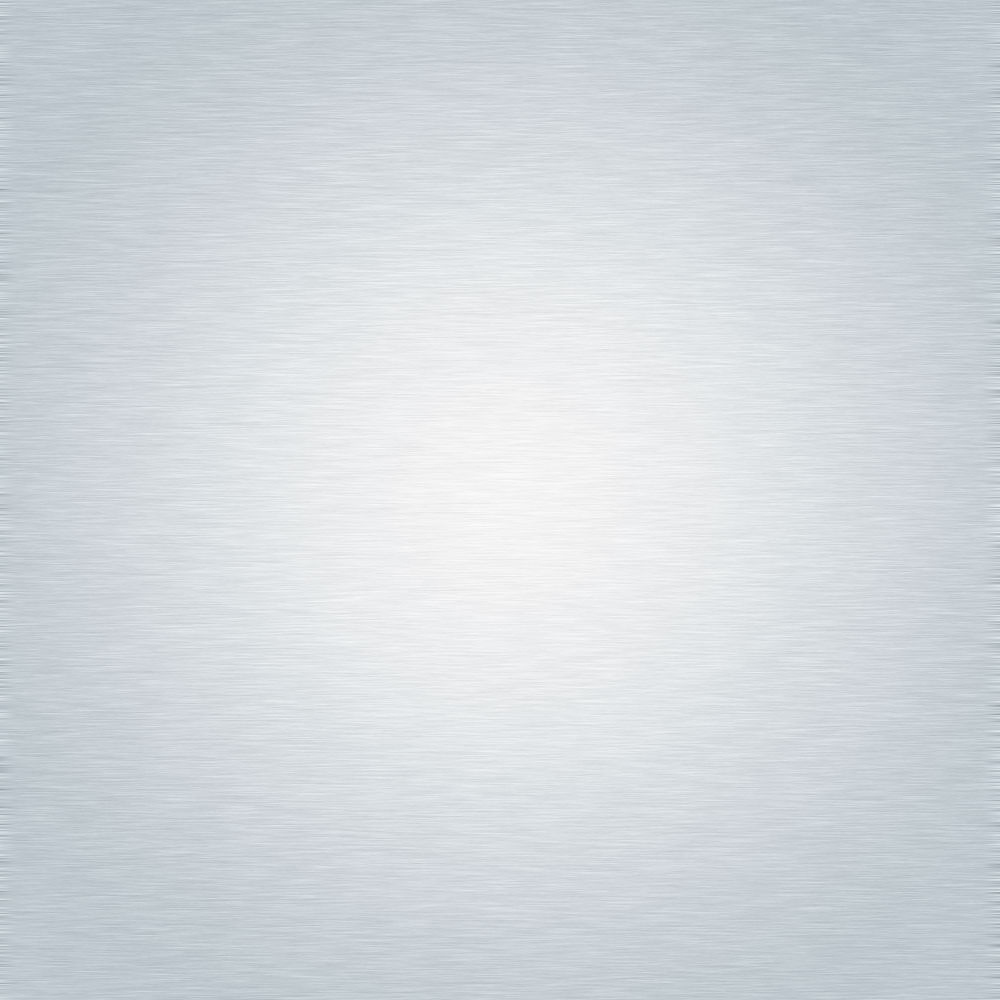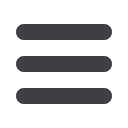
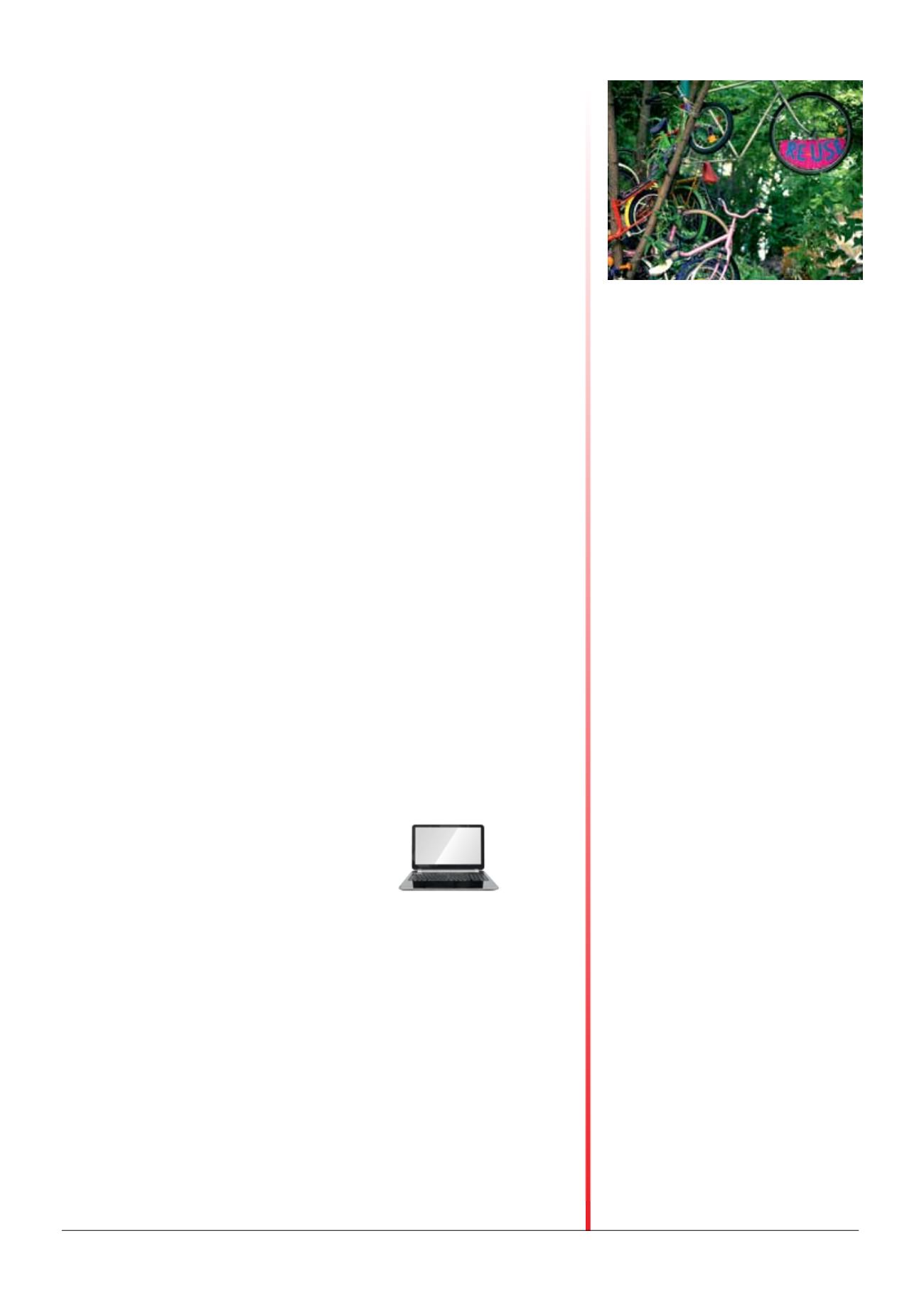
re in China, Russland, Kasachstan, den
USA und Indien. Um die von Österrei-
cherInnen verursachten Emissionen zu
reduzieren, sind also strenge Klimaver-
pflichtungen in diesen Ländern ebenso
wichtig. Der Fußabdruck der Österrei-
cherInnen steigt auch mit dem Einkom-
men (siehe Grafik Seite 16).
Die mit dem Einkommensniveau an-
steigenden Emissionen spiegeln unter-
schiedliche Verhaltensmuster und Le-
bensstile wider. Einkommensstärkere
Gruppen reisen z.B. häufiger mit dem
Flugzeug oder nutzen den PKW stär-
ker, legen also ein emissionsintensive-
res Mobilitätsverhalten an den Tag. Hier
könnte die Umweltpolitik mit Anreizen
zur Verhaltensänderung ansetzen. Im
Rahmen des Innovate-Projekts wurden
bisher Good-Practice-Beispiele aus
verschiedenen Ländern in den Berei-
chen Mobilität, Bauwirtschaft und Ge-
sundheit zusammengetragen. Beispiele
inkludieren Kfz-Steuersätze, die vom
CO
2
-Ausweis des Fahrzeugs abhän-
gen (Niederlande); Fahrradschnellwege
(Deutschland, Großbritannien); Kenn-
zeichnungssysteme für nachhaltiges
Bauen (Deutschland); und Förderungen
für gemeinschaftliches oder temporäres
Wohnen (Österreich, Großbritannien).
Auch im internationalen Länderver-
gleich zeigt der ökologische Fußabdruck
des Global Footprint Network aus dem
Jahr 2014, dass die entwickelten Länder
der westlichen Welt global gesehen den
höchsten Ressourcenverbrauch haben.
Ganz vorne mit einem Fußabdruck von
acht bis zehn Hektar pro Person liegen
Länder der arabischen Halbinsel, dicht
gefolgt von Dänemark, Belgien, Singa-
pur, den USA und Schweden. Österreich
liegt mit knapp unter sechs Hektar an 13.
Stelle, deutlich vor Frankreich, Deutsch-
land und Großbritannien. Im globalen
Durchschnitt werden mehr Ressourcen
verbraucht als die Kapazität der Erde
(1,8 Hektar pro Person) hergibt. Um den
momentanen Ressourcenverbrauch
aufrechtzuerhalten, wären 1,5 Planeten
nötig. Für eine Abkehr von diesem Trend
ist eine grundlegende Änderung unserer
Wirtschafts- und Verhaltensweisen not-
wendig.
¨
www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 3/2016
Seite 17
Umweltpolitik
Leitlinien
Damit Umweltpolitik und Verteilungsge-
rechtigkeit keinen Widerspruch darstel-
len, sollten
• Bemühungen zur Reduktion von
Luftschadstoff- und Lärmemissionen ver-
stärkt werden, da einkommensschwache
Bevölkerungsgruppen überdurchschnitt-
lich davon profitieren
• Umweltsteuern und -abgaben durch
gezielte Ausgleichszahlungen oder
Förderung von Energieeffizienzmaßnah-
men für sozial schwächere Gruppen so
ausgestaltet werden, dass sowohl eine
positive Umweltwirkung also auch eine
positive (oder zumindest keine negative)
Verteilungswirkung eintritt
• umweltbezogene Förderungen auf ihre
sozialen Auswirkungen überprüft werden
(z.B. kommen Förderungen für Solar-
anlagen und Elektroautos eher einkom-
mensstärkeren Schichten zugute) und
Förderungen mit negativen Umwelt- und
Verteilungswirkungen reformiert werden
(z.B. fördert das Pendlerpauschale den
motorisierten Individualverkehr und wird
eher von Beziehern höherer Einkommen
in Anspruch genommen)
• umweltpolitische Maßnahmen zur
Reduktion von Ressourcenverbrauch
und Treibhausgas-Emissionen bei den
Gruppen ansetzen, die am meisten zum
Problem beitragen, da hier der größte Ef-
fekt pro Person erzielt werden kann. Da-
für sind Anreize zur Verhaltensänderung,
zum Beispiel beim Mobilitätsverhalten
einkommensstarker Gruppen, und eine
generelle Abkehr von der Konsum- und
Wegwerfgesellschaft in der industrialisier-
ten Welt nötig.
Global Footprint Network
Die Berichte des Netzwerkes berechnen
für jedes Land der Erde, wieviel Fläche an
biologisch fruchtbarem Boden ein Mensch
beansprucht, um seinen Konsum zu de-
cken und seine fossilen Emissionen zu ab-
sorbieren. Der resultierende menschliche
Ressourcenverbrauch wird in der Einheit
„globaler Hektar pro Person“ dargestellt:
www.footprintnetwork.org/pt/index.php/GFN/page/living_planet_report2/
Tipp
Innovate-Projekt
Unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Karl Steininger,
Universität Graz, Wegener Center für Klima und
Globalen Wandel (2015-2018): http://wegcwww.
uni-graz.at/wp/innovate/Traditionell werden
Emissionen nach Ver-
ursacherInnen inner-
halb nationaler Gren-
zen bilanziert. Kom-
plementär dazu be-
trachtet der konsum-
basierte Ansatz Emis-
sionen, die durch die
KonsumentInnen eines
Landes verursacht
werden. Diese entste-
hen entlang der Wert-
schöpfungskette der
konsumierten Güter,
also über Importe
auch außerhalb natio-
naler Grenzen.