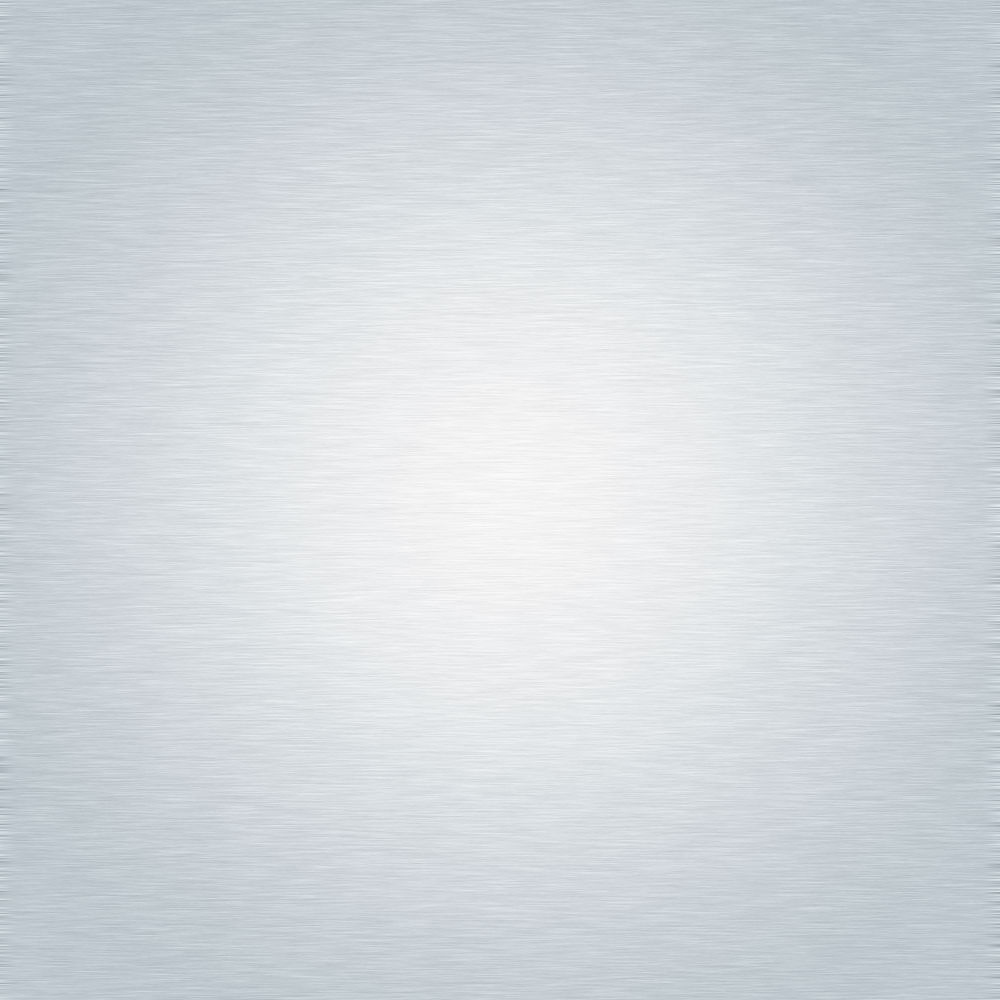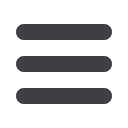
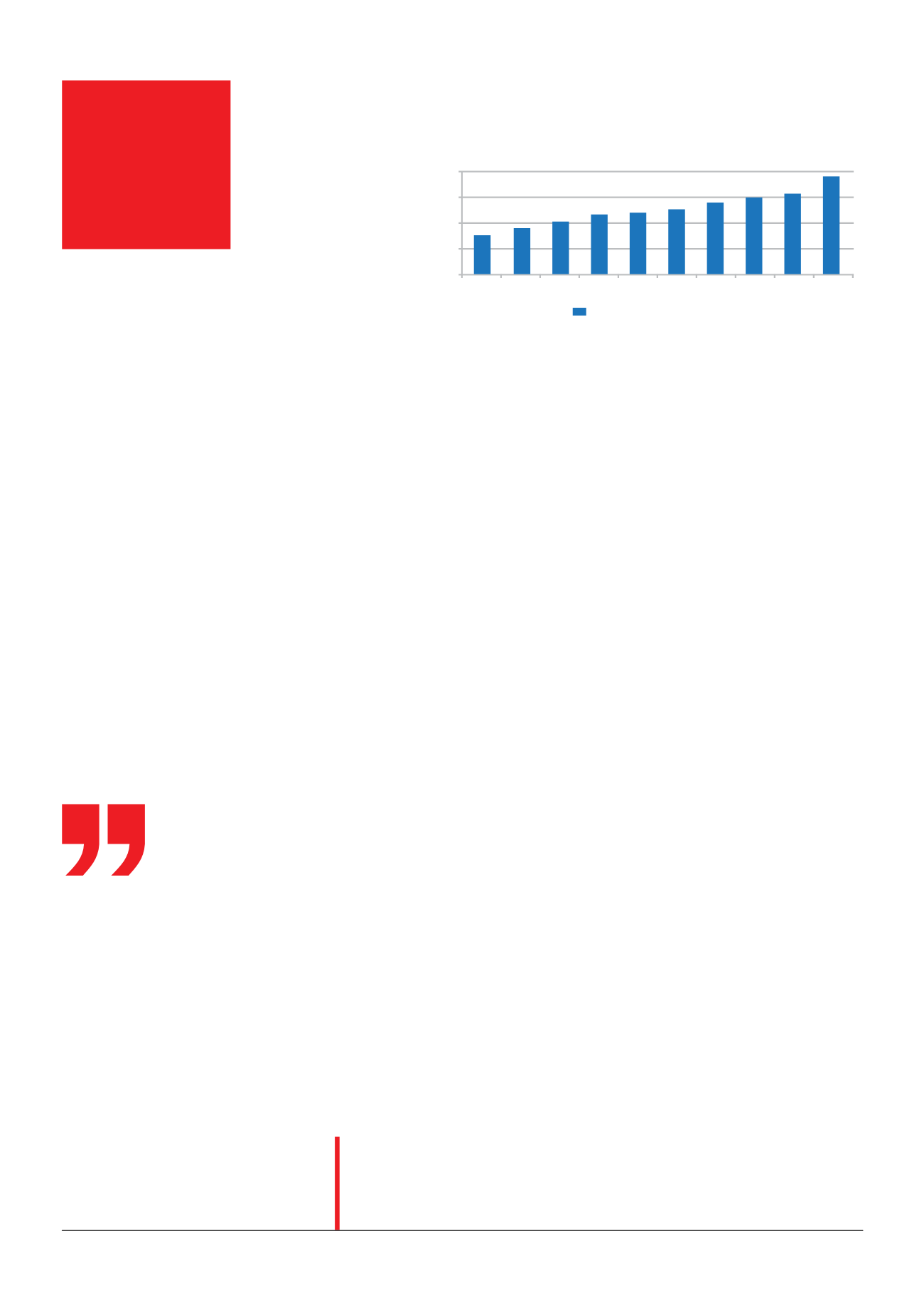
heitlichen Effekte haben wiederum
negative Auswirkungen auf Lebensein-
kommen und Lebenserwartung.
In Österreich werden diese Zusam-
menhänge bislang nicht systematisch
erfasst. Eine Analyse der Statistik Aus
tria aus dem Jahr 2014 zeigt erstmals
die Betroffenheit verschiedener Ein-
kommensgruppen durch Umweltbe-
lastungen. Es zeigt sich ein deutliches
Gefälle nach Einkommensgruppen (Jah-
reshaushaltseinkommen): Menschen
mit niedrigem Einkommen fühlen sich
deutlich stärker durch Lärm, Gerüche/
Abgase und Staub/Ruß imWohnbereich
belastet als jene mit hohemEinkommen.
Umweltpolitische Maßnahmen, die
Schadstoff- und Lärmemissionen etwa
aus Industrie und Verkehr reduzieren,
können die Verteilungsgerechtigkeit er-
höhen, weil sie Gesundheit und damit
auch das zu erwartende Lebensein-
kommen sozial Schwächerer steigern.
Quantifizierungen dieser Wirkungen auf
die Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen existieren für Österreich bisher
nicht.
Bei der Umsetzung umweltpolitisch
relevanter Maßnahmen wie Steuern
und Förderungen ist zu beachten, dass
diese häufig regressiv wirken, d.h. sie
stellen für untere Einkommensgruppen
im Verhältnis zu ihrem Einkommen eine
größere Belastung dar. Besonders für
die direkte Besteuerung von Energie-
verbrauch wie Abgaben auf Brennstof-
fe oder Elektrizität wurde dieser Effekt
nachgewiesen. Das liegt daran, dass
sozial Schwächere relativ gesehen ei-
nen größeren Anteil ihres verfügbaren
Haushaltseinkommens für notwendige
Ausgaben wie Heizung und Warmwas-
ser aufwenden müssen und über we-
niger Substitutionsmöglichkeiten ver-
fügen. Durch Ausgleichszahlungen an
betroffene Haushalte kann dies jedoch
kompensiert werden, z.B. in Form von
Gutschriften und Rückvergütungen,
oder durch die Förderung von Maß-
nahmen zur Verringerung des Energie-
bedarfs für Einkommensschwächere.
Auf diesem Weg könnte sogar erreicht
werden, dass umweltpolitische Maß-
nahmen eine positive Verteilungswir-
kung haben. Das erfordert jedoch eine
genaue Analyse des länderspezifischen
Steuer- und Transfersystems und des-
sen Wirkung auf verschiedene Einkom-
mensgruppen.
Umwelt- und klimapolitische Maß-
nahmen sind umso effektiver, je mehr
sie bei den AkteurInnen ansetzen, de-
ren Verhalten am meisten zu Umwelt-
problemen beiträgt. Die Bilanzierung
sogenannter „konsumbasierter“ Emis-
sionen (auch ökologischer Fußabdruck
genannt) zeigt, dass sowohl innerhalb
Österreichs als auch im internationalen
Vergleich die Einkommensstärksten für
hohe Treibhausgas (THG)-Emissionen
und einen überproportionalen Ressour-
cenverbrauch verantwortlich sind. Über
Anreize zur Verhaltensänderung die-
ser Bevölkerungsgruppen und Länder
könnte daher sehr viel erreicht werden.
Ansatzpunkte für
Umweltgerechtigkeit
Ergebnisse eines aktuell unter Be-
teiligung des Umweltbundesamtes lau-
fenden Forschungsprojekts („Innovate“,
gefördert durch den Klima- und Ener-
giefonds) zeigen, dass nach konsumba-
sierter Betrachtungsweise Österreichs
THG-Emissionen um 50 Prozent höher
sind als nach traditioneller Berechnung.
Durch den österreichischen Konsum
fallen also zusätzlich zu den im Inland
verursachten Emissionen in anderen
Ländern noch einmal halb so viele Emis-
sionen an. Mehr als ein Drittel der kon-
sumbasierten Emissionen Österreichs
entsteht außerhalb der EU, insbesonde-
Schwerpunkt
Umwelt und
Verteilungs
gerechtigkeit
0,00
je Einkommmensdezil
3,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,7 4,1
4,7 4,8 5,1
5,5
6,0 6,3
7,6
CO
2
Tonnen pro Person
2,00
4,00
6,00
8,00
Durchschnittlicher Treibhausgas (THG)-Fußabdruck pro Kopf
nach Einkommensdezilen in Österreich (2004)
www.ak-umwelt.atMehr als ein Drittel der konsumbasierten
Emissionen Österreichs entsteht außerhalb
der Europäischen Union.
Umweltbetroffenheit
Statistik Austria-Studie: „Umweltbetroffenheit und -verhalten von Personengruppen abhängig von
Einkommen und Kaufkraft“:
www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=076174, Wien 2014
Seite 16
Wirtschaft & Umwelt 3/2016
ª
FOTOS: iStock/annedde (1)
Quelle: Innovate-Projekt, gefördert durch den Klima- und Energiefonds), Factsheet 2
„Konsumbasierte Emissionen Österreichs“, 2015
Im Jahr 2004 war das oberste Zehntel in der Verteilung der Haus-
haltseinkommen durchschnittlich für mehr als doppelt so hohe
THG-Emissionen verantwortlich als das unterste Zehntel (die zehn
Prozent der österreichischen Haushalte mit dem niedrigsten Ein-
kommen).