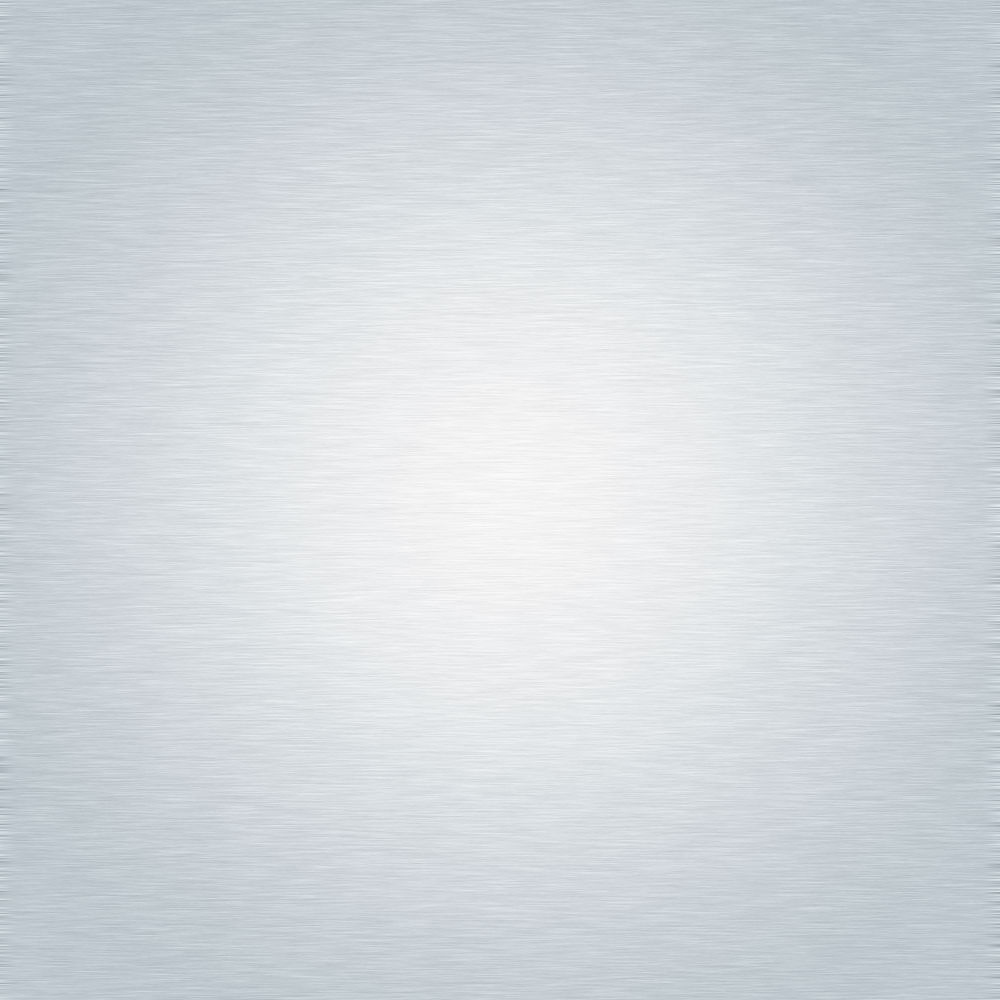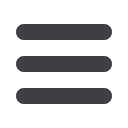
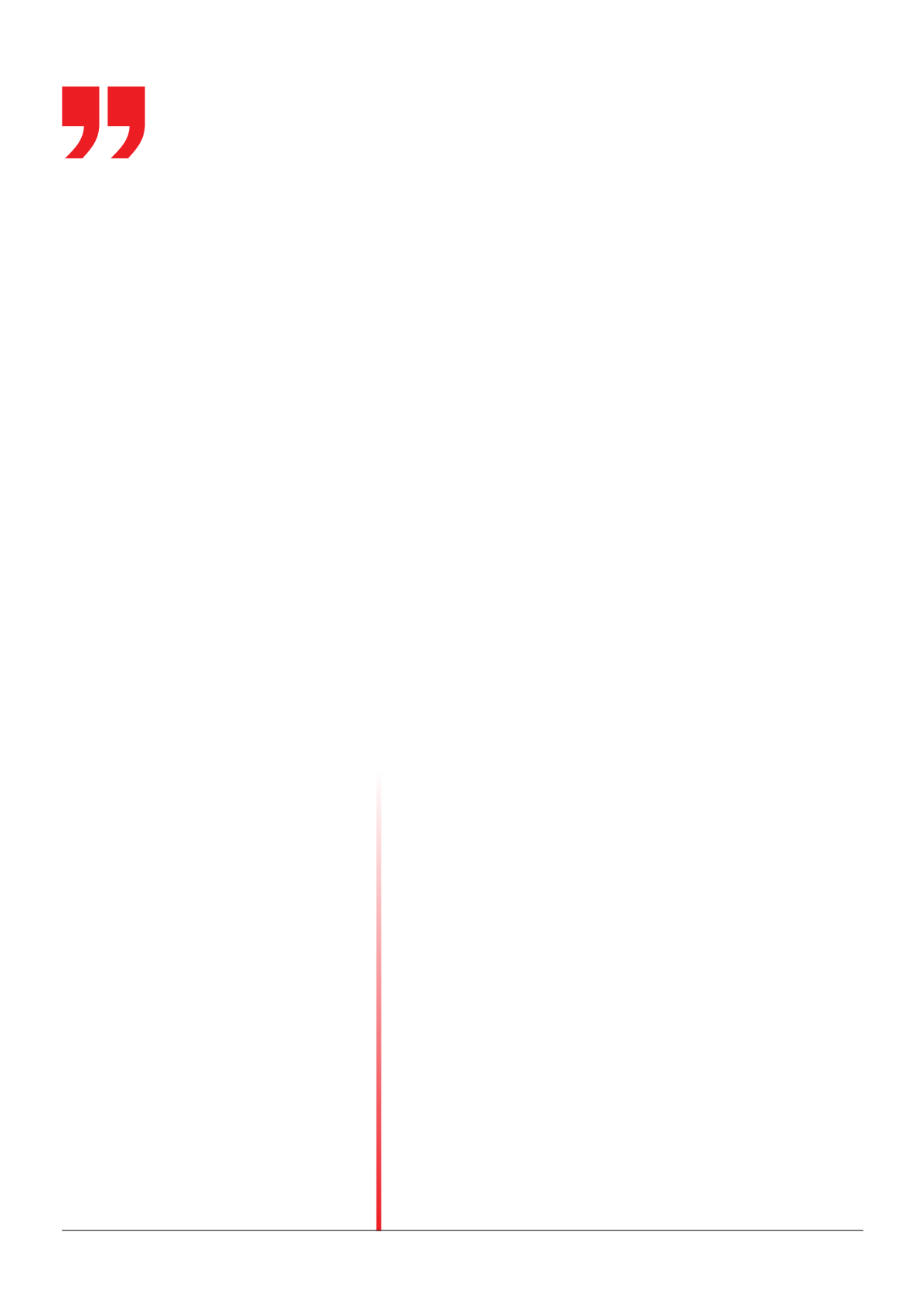
Die Antworten auf diese Fragen dürften
sich nicht zuletzt je nach Entstehungsge-
schichte der ungleichen Verteilung von
Belastungen unterscheiden. Sank die
Wohn- und Umweltqualität gemeinsam
mit allgemeinen Erscheinungen städti-
schen Verfalls? Oder wurden belastende
Anlagen gezielt an Orten angesiedelt, an
denen wenig Widerstand zu erwarten
ist? Haben Betroffene aufgrund niedriger
Immobilienpreise ihren Wohnort freiwillig
in Flughafennähe gewählt?
Preisendörfer (siehe Fußzeile Seite
11) zufolge ist dann ein gewisses Maß an
Ungerechtigkeit zu vermuten, wenn
• die sozial-räumlichen Ungleichheiten
besonders ausgeprägt sind oder
• die Umweltbelastungen jenseits zu-
mutbarer Niveaus liegen,
• eine Kumulation von Nachteilen be-
steht (bspw. kein Ausgleich durch kurzen
Arbeitsweg),
• das subjektive Wohlbefinden maß-
geblich beeinträchtigt ist,
• NutznießerInnen und Betroffene der
Belastung auseinanderfallen,
• die Betroffenen nicht ausweichen
können oder
• über unzureichende Mitwirkungs-
bzw. Mitgestaltungsmöglichkeiten ver-
fügen.
Die Bewertung der relevanten Varia-
blen bleibt dennoch komplex. Wie soll
berücksichtigt werden, dass Arbeitslose
meist mehr Zeit am Wohnort verbringen
als Berufstätige? Wie werden subjektive
Einschätzungen im Vergleich mit objek-
tiven (Umwelt-)Daten gewichtet? Letzt-
endlich liefern die betrachteten Überle-
gungen immer nur Hinweise für weiter-
führende Diskussionen.
Erweiterung des Blicks
Die dargestellte Diskussion zu „en-
vironmental justice“ fokussiert häufig
auf die kleinräumige Verteilung von
Umweltbelastungen. Intergeneratio-
nale und internationale Aspekte sowie
die Nutzung von (globalen) Umwelt-
gütern werden seltener in den Blick
genommen. Es scheint aber durchaus
lohnend, die Perspektive zu öffnen.
Insbesondere vor dem Hintergrund der
Weltklimaziele stellt sich nicht nur die
Frage, welche Gesellschaften einen zu
hohen Ausstoß an Treibhausgasen ha-
ben, sondern auch, für welche sozialen
Gruppen das in besonderem Maße gilt.
Global 2000 hat bereits 2008 eine Stu-
die zu „Sozialen Aspekten von Climate
Change Impacts in Österreich“ beauf-
tragt. Diese zeigte, dass Wohlhabende
aufgrund ihres Urlaubs- und Mobilitäts-
verhaltens und wegen der Brennstoffe,
die sie in ihren Heizsystemen einsetzen,
einen überproportionalen Beitrag zum
Klimawandel leisten. Ärmere sind aber
von klimawandel- und klimapolitikbe-
dingten Preissteigerungen bei Energie
und Nahrungsmitteln stärker betroffen.
Darüber hinaus können sie sich Inves-
titionen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz – thermische Sanierung, energie-
effiziente Geräte – oftmals nicht leisten.
Auch die Statistik Austria hat sich in
letzter Zeit systematisch mit den Zu-
sammenhängen zwischen Einkommen
und ausgewählten Umweltaspekten be-
schäftigt. So wurden 2014 in einer um-
fassenden Studie erstmals die umwelt-
bezogenen Beobachtungen des Mikro-
zensus mit Einkommensdaten aus der
EU-Statistik über Einkommen und Le-
bensbedingungen (EU-SILC) verschnit-
ten. Dabei zeigte sich nicht nur, dass ein-
kommensschwächere Gruppen stärker
unter lokalen Umweltbelastungen leiden
(siehe Beitrag Seite 14), auch der Kon-
sum von biologisch erzeugten Lebens-
mitteln ist weniger verbreitet. Gleich-
zeitig sind sie stärker auf die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen.
Die Einkommensverteilung bestimmt
also schon heute über den Zugang zu
gesunden Wohnverhältnissen, Mobili-
tätsformen, hochwertigen Lebensmitteln
und Energie. Nicht zuletzt angesichts der
geplanten massiven Reduktion des Aus-
stoßes von Treibhausgasen in der relativ
nahen Zukunft sind klimapolitisch moti-
vierte Maßnahmen – wie Abgabenände-
rungen und Förderungen (siehe Beitrag
Seite 18) – daher stets auf ihre Vertei-
lungs- (und Beschäftigungs-)wirkungen
zu prüfen.
¨
Modellprojekt in Berlin
Umweltgerechtigkeitsmonitoring
Die Stadt Berlin hat ab dem Jahr
2008 in einem ressortübergreifenden
Modellprojekt die Grundlagen für
die Verknüpfung von Umwelt- und
Gesundheitspolitik geschaffen. Im
Fokus stehen neben gesundheits-
relevanten Umweltbelastungen die
soziale Problemdichte auf Quartiers
ebene sowie die Vulnerabilität im
Zusammenhang mit dem Klimawan-
del. Die Erhebung und Aufbereitung
der Daten zu den ausgewählten
Themenkomplexen erfolgt dabei in
enger Abstimmung mit Forschungs-
einrichtungen und dem regionalen
Statistikamt. Von 2010 bis 2013
wurde damit erstmals in Deutsch-
land auf städtischer Ebene ein
„Umweltgerechtigkeitsmonitoring“
implementiert. Darin werden quar-
tiersbezogene Daten zu Bioklima,
Luftqualität, Lärmbelastung und
Grünraumversorgung mit Daten zur
sozialen Problemdichte verschnitten.
Gesundheitsdaten zu Adipositas im
Einschulungsalter, vorzeitiger Sterb-
lichkeit und Krebs(neu)erkrankun-
gen, aber auch Daten zur Bau- und
Stadtstruktur werden ergänzend
miteinbezogen. Aus der kleinräumi-
gen Belastungsanalyse sollen in der
Folge Ausgleichskonzepte entwickelt
und im Rahmen der stadtpolitischen
Handlungsmöglichkeiten – von der
Flächennutzungsplanung bis zum
innerstädtischen Finanzausgleich –
auch umgesetzt werden.
Für nähere Informationen siehe:
www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/i901.htm
Environmental Justice: Vom politischen
Schlagwort zum Rahmen für wissen
schaftliche Untersuchungen.
www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 3/2016
Seite 13