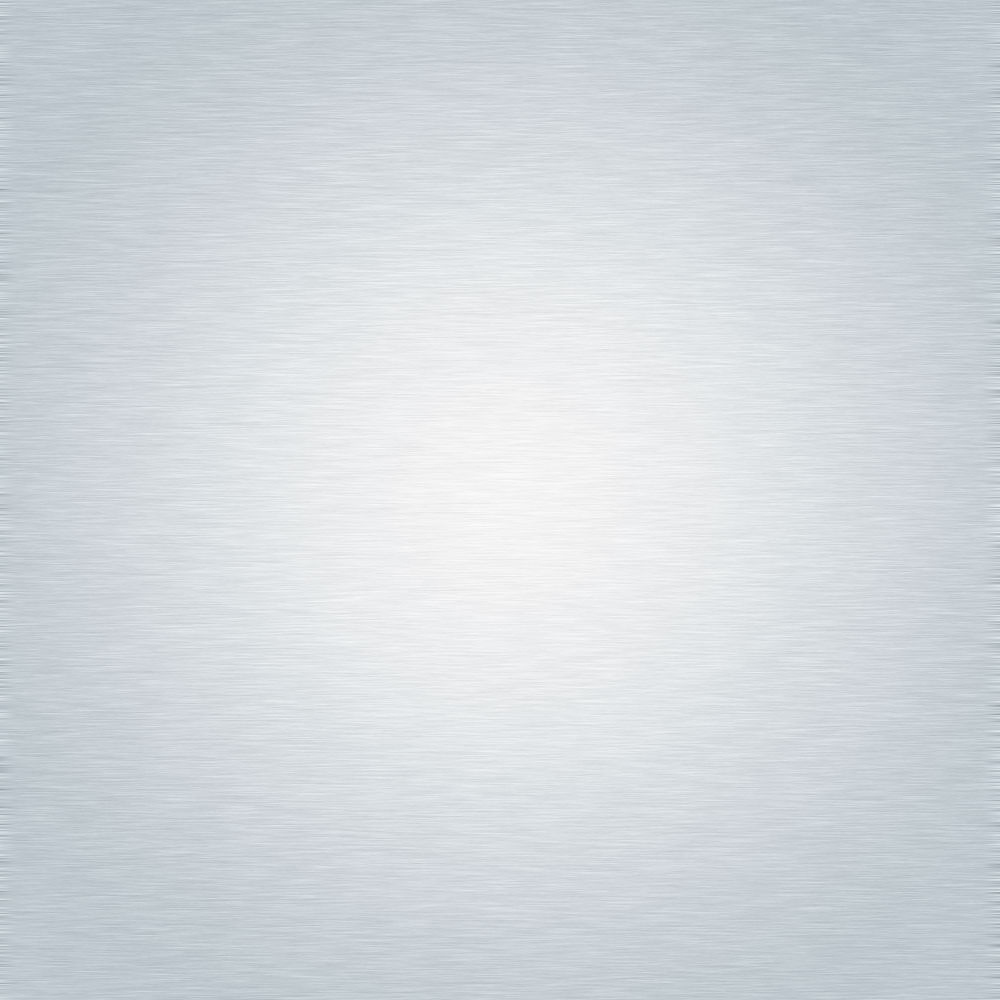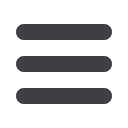

Aussagen der Firmen zur Verei-
nigungsfreiheit und Kollektivver-
handlungen: Teilweise lassen die
Unternehmen Gewerkschaften
zu, ein aktives Bekenntnis zur
Vereinigungsfreiheit – so wie das
dieUN-Richtlinienvorsehen–gibt
es jedoch nur von einem Unter-
nehmen. Die Firmen müssen hier
noch viel mehr Anstrengungen
unternehmen, um aktiv diesen
Zugang zu Arbeitnehmergrund-
rechten in den produzierenden
Ländern zu gewährleisten.
Wenig Wissen
ImVergleich zur Textilindustrie
haben KonsumentInnen recht
wenige Informationen über die
Produktionsbedingungen von
Schuhen und auch deren öko-
logische Auswirkungen. In einer
Befragung von 10.000 europä-
ischen BürgerInnen im Rahmen
des Projektes bekennen fast drei
Viertel aller Befragten, dass sie
wenig bis kein Wissen über die
Bedingungen in der Schuhpro-
duktion besitzen. Laut eigenen
Angaben geben die Österreiche-
rInnen im Schnitt 205 Euro pro
Jahr für Schuhe aus. Zwei Drittel
der ÖsterreicherInnen wären be-
reit, mindestens zehn Prozent
mehr für ökologisch und sozial
fair produzierte Schuhe zu be-
zahlen. 63 Prozent aller Europä-
erInnen sind der Meinung, die EU
soll bei den importierten Waren
auch auf die Sicherstellung von
Arbeitsrechten achten.
Auch in der Firmenbefragung
spiegelt sich die mangelnde
Transparenz wider: Es gibt kaum
oder nur sehr spärliche Informa-
tionen auf den Firmenwebseiten
über soziale oder ökologische
Standards. Ausnahme sind nur
eine Handvoll Firmen wie z.B.
Euro Sko: Das Unternehmen ver-
öffentlicht den Code of Conduct,
die Liste über ausgeschlossene
Substanzen sowie die Liste über
ihre Zulieferbetriebe und Leder-
gerbereien. Für KonsumentInnen
ist es im Allgemeinen äußerst
schwierig, sich über die Grund-
sätze der Firmen zu informieren.
Besonders bei den österreichi-
schen Betrieben besteht hier viel
Aufholbedarf.
Viele KonsumentInnen sehen
einen Zusammenhang zwischen
„Made in Europe“ und guten
Arbeitsbedingungen. Doch al-
lein der Produktionsstandort ist
noch kein Hinweis auf die Qua-
lität der Arbeitsbedingungen.
So klafft die Lücke zwischen
gesetzlichem Mindestlohn und
einem Lohn, von dem die eigene
Existenz gesichert ist, gerade in
Osteuropa oft stärker auseinan-
der als in asiatischen Ländern.
In Mazedonien etwa beträgt der
legale Mindestlohn 145 Euro mo-
natlich, um halbwegs gut über
die Runden zu kommen, würde
jedoch eine vierköpfige Familie
mindestens 726 Euro zum Leben
benötigen. Im Vergleich dazu
beträgt in China der gesetzliche
Mindestlohn 175 Euro, hier rei-
chen jedoch „schon“ 376 Euro
für ein Mindestauskommen.
Im Projekt wurden nicht nur
die sozialen Bedingungen in
der Produktion, sondern auch
die Umweltwirkungen der Fa-
brikate untersucht. Fleisch- und
Lederproduktion hängen zu-
sammen und verbrauchen viele
Ressourcen: Für ein Kilo roher
Rinderhaut werden 17.000 Liter
Wasser, 7,4 kg Getreide und 41
kg Viehfutter benötigt. Aus
Made in Europe ist überhaupt
kein Hinweis auf faire
Entlohnung.
www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 3/2016
Seite 23
Laut den UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte sind
neben Staaten auch Unternehmen
dafür verantwortlich, regelmäßig die
Einhaltung der Arbeits- und Men-
schenrechte zu überprüfen. Dies betrifft insbeson-
dere große Konzerne, die oft lange Lieferketten und
viele Subkontraktoren haben. Wenn der gesetzliche
Mindestlohn eigentlich nicht zum Leben ausreicht,
sind Unternehmen auch verpflichtet, Maßnahmen
dagegen zu setzen. Das heißt, dass sich die Firmen
mit dem Thema existenzsichernde Löhne in den
Produktionsstätten auseinandersetzen müssen.
Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Lieferketten
transparent und rückführbar sind.
Wirtschaft und Menschenrechte
„UN-Leitprinzipien“
Umweltzeichen für Schuhe
Seit Juli 2014 gibt es in Österreich auch ein Umweltzeichen für
Schuhe: Hier müssen neben strengen Umweltkriterien auch
soziale Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Siehe:
www.umweltzeichen.atQuelle:
cleanclothes.at/de; LabourOnAShoestring
ª
32%
318
Polen
1000
26%
354
Slowakei
1360
22%
156
Rumänien
706
20%
145
Mazedonien
726
19%
164
Bosnien-Herzegowina
859
24%
140
Albanien
588
Schuhe „Made in Europe“ – zu Hungerlöhnen
Kluft zwischen gesetzlichem Mindestlohn und geschätztem Existenzminimum
Gesetzlicher Netto-Mindestlohn
in der Schuhindustrie 1. 1. 2016
Geschätztes niedrigstes
Existenzminimum einer
vierköpfigen Familie auf Basis
von Interviews mit Arbeitern