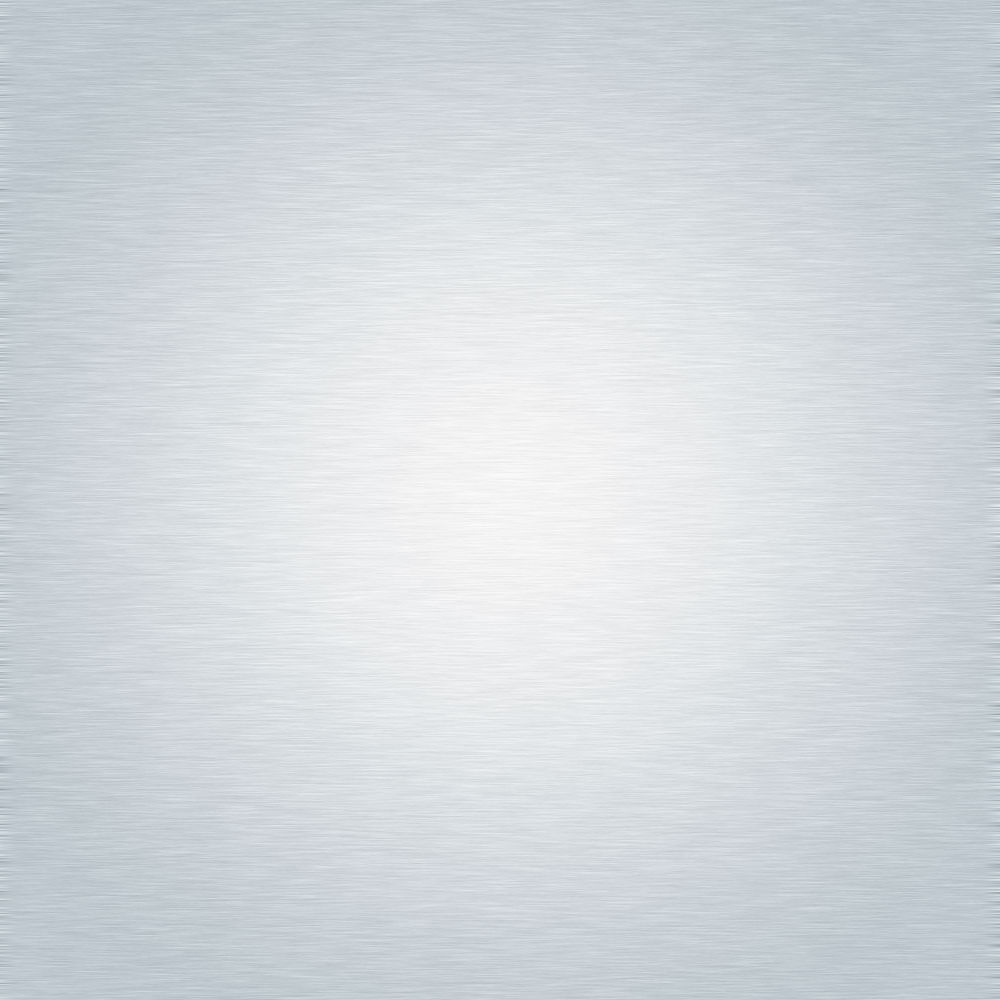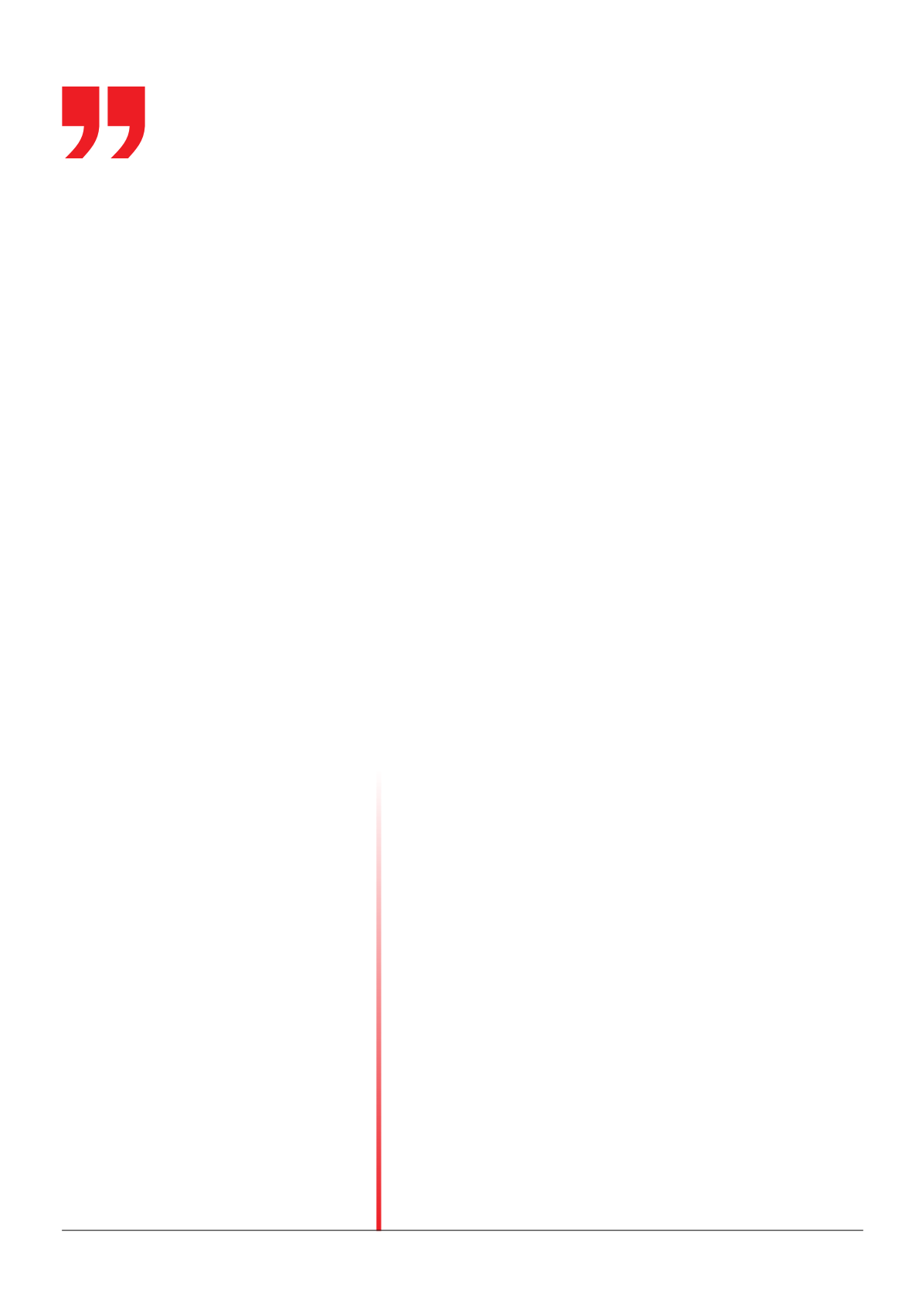
derungen aus der Entsorgungswirtschaft
nach Absenkung von Umweltstandards,
um das Recycling zu fördern. Die merk-
liche Verringerung der Umweltbelastun-
gen muss jedoch das Ziel bleiben. Daher
gilt es, diese in ihrer Gesamtheit im Auge
zu behalten, um daraus verlässlich die
relevanten Handlungsfelder und Instru-
mente für die nächsten Jahre ableiten zu
können.
Vorbildhaft in diesemZusammenhang
ist das Herangehen des Schweizer Bun-
desamts für Umwelt (BAFU). 2011 hat es
erstmals die gesamte Umweltbelastung
durch Konsum und Produktion in der
Schweiz ermitteln lassen. Auffallends-
tes Ergebnis der Studie ist, dass Importe
etwa 60 % der gesamten Umweltbelas-
tung der Schweiz ausmachen. Dies ver-
deutlicht die Abhängigkeit der Schweiz
von den natürlichen Ressourcen und
Produktionsprozessen im Ausland und
macht auch die Mitverantwortung für
den globalen Umweltzustand ersichtlich.
Die ökologisch relevantesten Konsum-
bereiche sind dabei Ernährung undWoh-
nen mit je 28 % sowie Mobilität mit zwölf
Prozent. Nicht nur insgesamt fällt der
große Anteil der im Ausland anfallenden
Umweltbelastungen auf: In den meisten
Konsumbereichen ist dieser bedeutend
größer als im Inland. Nur der Konsum-
bereich Mobilität verursacht etwas mehr
Umweltbelastungen in der Schweiz als
im Ausland. Die Analyse der Umwelt-
belastung in der Schweiz nach den
verschiedenen Wirtschaftsbranchen
(ohne Exporte) zeigt, dass Landwirt-
schaft (30%), Energiewirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Gastgewerbe und Transport-
gewerbe amstärksten insGewicht fallen.
Ein vergleichbar systematischer Zugang
fehlt auf EU-Ebene.
Ein durchwachsenes Bild zeigen auch
die von der Kommission in Aussicht ge-
stellten volkswirtschaftlichen Effekte.
Beim ersten Paket verspricht die Kom-
mission noch die Schaffung von 2 Mio.
Arbeitsplätzen. Beim zweiten waren es
nur mehr rund 600.000, ohne dass dies
besser nachvollziehbar geworden wäre.
Der Umgang mit Zahlen ist salopp. Gre-
mien wie die Europäische Plattform für
Ressourceneffizienz oder Think Tanks
wie die Ellen MacArthur-Foundation
schaffen keine zusätzliche Legitimati-
on, da hier die Wirtschaft mit sich sel-
ber diskutiert. Die AK hat schon zum
ersten Paket betont, dass beide Seiten
der Sozialpartner bei der Ermittlung von
Wohlfahrts- und Beschäftigungseffekten
von Anfang an und systematisch einbe-
zogen werden sollten. Der soziale Dialog
wird nicht nur zu Ausbildungsfragen ge-
braucht.
Abfallwirtschaft konkret
Nur für die Abfallwirtschaft liegen
schon Legislativvorschläge vor. Wich-
tigster Punkt ist, die viel zu lange Über-
gangsfrist der EU-Deponie-Richtlinie
für das unbehandelte Ablagern von
Abfällen zurückzuschrauben. Etliche
Mitgliedstaaten werden hier großen
Widerstand leisten, obwohl ein mit-
telfristiges Deponierungsverbot noch
besser wäre. Positiv ist, dass es end-
lich Überlegungen für eigene ziffern-
mäßige Abfallvermeidungsziele gibt.
Wichtig sind auch die Vorschläge zu
mehr Transparenz und Kontrolle bei
den Abfallsammelsystemen. In vielen
Staaten gibt es monopolartige Syste-
me wie es das österreichische ARA-
System lange war. Maßnahmen gegen
In-Sich-Geschäfte sind hier dringend
nötig, wie das EU-ARA-Wettbewerbs-
verfahren zeigt. Die Kommission hat
hier eine Strafe von sechs Millionen
Euro über ARA verhängt. Noch immer
fehlt die Klarstellung, dass es eine von
Wirtschaftsinteressen unabhängige
Konsumenteninformation zu Abfallver-
meidung braucht. In die einzurichten-
den Dialogplattformen müssen auch
KonsumentenvertreterInnen einbezo-
gen werden. Im Jänner 2017 soll über
die Änderungsvorschläge abgestimmt
werden. Zentraler Streitpunkt dürfte der
Wunsch aus der Wirtschaft sein, dass
die Kommunen nur mehr für die Ent-
sorgung der Privathaushalte zuständig
sein sollen. Nach Visionen für eine bes-
sere Welt klingt das nicht, eher nach
„altem Wein in neuen Schläuchen“.
¨
Hintergrund
BAFU ermittelt Umweltbelastung
Um bessere Entscheidungsgrundla-
gen für seine Empfehlungen an die
Politik zu haben, hat das schwei-
zerische Bundesamt für Umwelt
(BAFU) 2011 erstmals die gesamte
Umweltbelastung durch Konsum und
Produktion in der Schweiz ermitteln
lassen: Den gesamten Lebens-
weg der Produkte zu betrachten
war wichtig, weil viele Güter in die
Schweiz importiert werden und so
eine Betrachtung der bloß im Inland
anfallenden Umweltbelastungen
zu kurz greift. Um diese zu einer
Gesamtbelastung zusammenzufas-
sen, wurden sie mit der Methode der
ökologischen Knappheit als „Um-
weltbelastungspunkte“ quantifiziert.
Diese bewerten unterschiedliche
Emissionen in Boden, Wasser und
Luft sowie den Verbrauch von natür-
lichen Ressourcen. Treibhausgase
werden ebenso betrachtet wie die
Gewässerverschmutzung bis hin zur
Landnutzung. 2014 hat das BAFU
nach der gleichen Methode die Ent-
wicklung der Schweizer Umweltbe-
lastungen zwischen 1996 und 2011
untersuchen lassen: Signifikantestes
Ergebnis ist, dass die Umweltbelas-
tung im Inland deutlich abgenommen
hat, aber durch die zunehmen-
de Umweltbelastung im Ausland
weitgehend kompensiert worden ist.
Der im Ausland verursachte Anteil
ist von 1996 bis 2011 von rund 56%
auf rund 73% gestiegen. Um ein
naturverträgliches Maß zu erreichen,
müsste die Gesamtbelastung halbiert
werden, so das BAFU.
www.bafu.chWas die Vorhaben des Aktionsplans
der EU-Kommission wert sind, wird
sich erst zeigen.
www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 4/2016
Seite 13