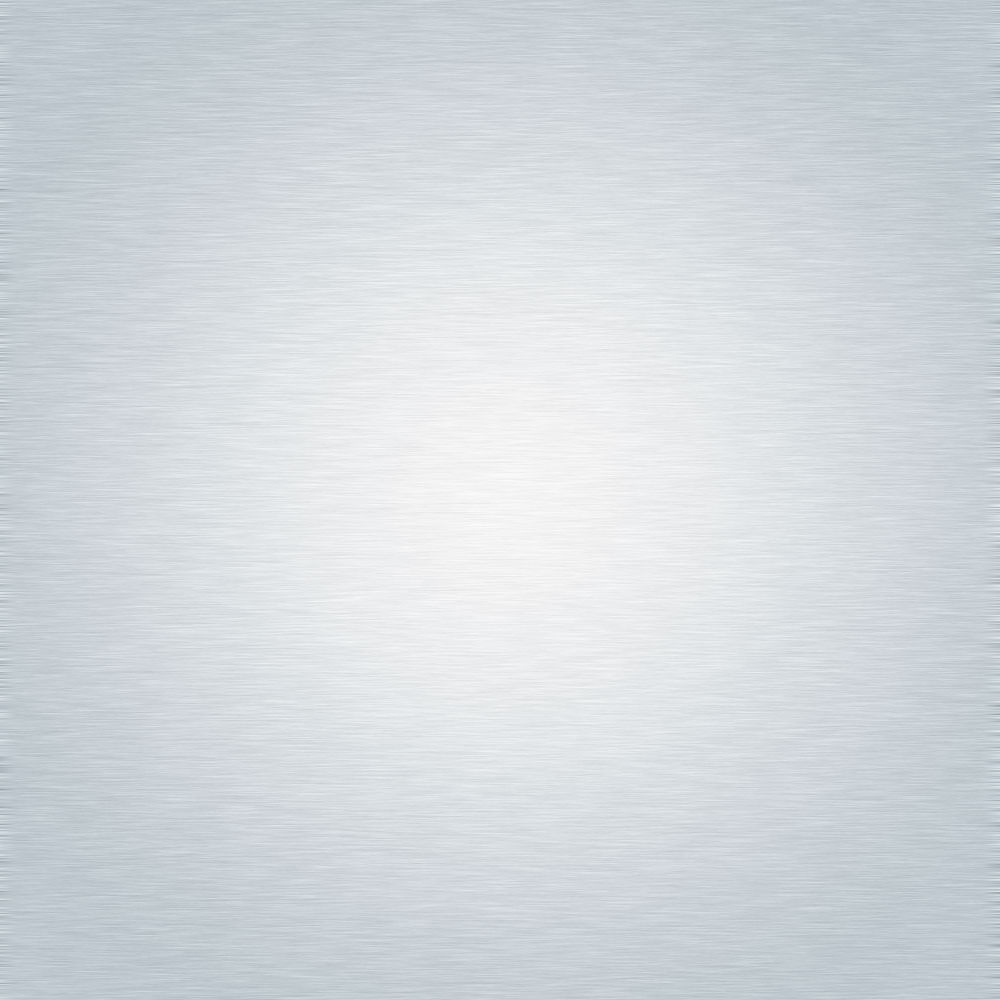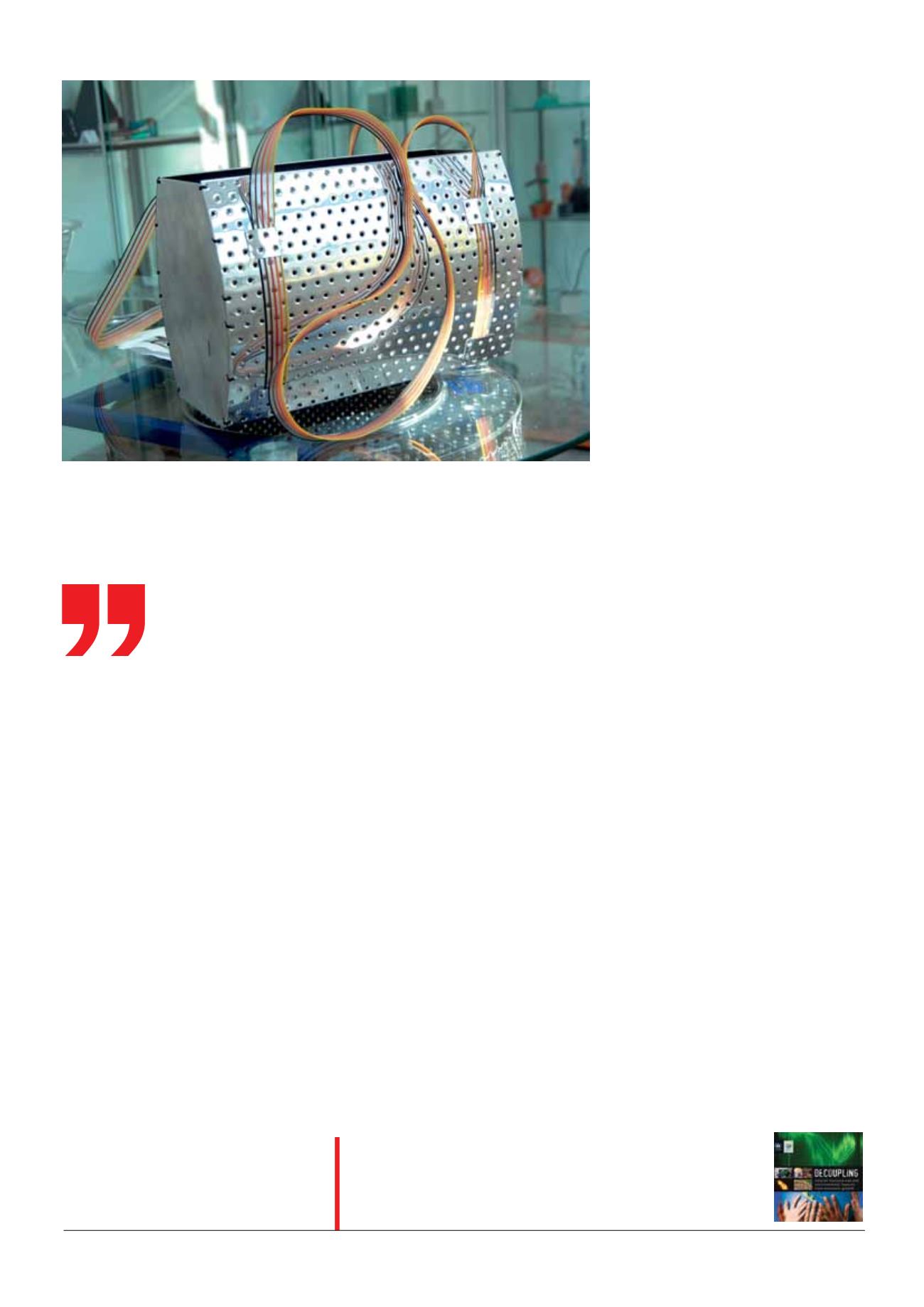 www.arbeiterkammer.at
www.arbeiterkammer.at
Wirtschaft & Umwelt 4/2016
Seite 19
völkerung darauf zählen, dank dieses
großen Energieüberschusses beliebige
Mengen der unterschiedlichsten Ma-
terialien für seinen Alltagskomfort zu
nützen, völlig ungeachtet ihrer plane-
taren Regenerierbarkeit. Zunehmend
zeichnet sich jedoch ab, dass das nicht
einfach so weitergeht: Das Verbrennen
fossiler Energieträger droht das Klima
zu kippen, die meisten strategischen
Rohstoffe werden sogar bei derzeitigen
Nutzungsraten in den nächsten Jahr-
zehnten den Höhepunkt ihrer Förder-
barkeit überschreiten („peak“; Sverdrup
& Ragnarsdottir, 2014). Ein Wachstums-
spielraum, der zuließe, dass die übrigen
drei Viertel der Weltbevölkerung eine
ähnlich verschwenderische Lebens-
weise entwickeln, ist nicht gegeben.
Einem großen Teil von ihnen gelingt es
nicht, das agrargesellschaftliche Muster
von Armut und hohem Bevölkerungs-
wachstum zu verlassen. Das Internatio-
nal Resource Panel (IRP 2011) schätzt,
dass eine global konvergente Lebens-
weise im besten Fall auf dem halben
Durchschnittsniveau des gegenwärti-
gen Ressourcenverbrauchs westlicher
Industrieländer möglich wäre.
EU-Ressourcenpolitik
Anfangs durch Reduktionsziele ge-
kennzeichnet, wird heute von der EU
das Konzept einer „circular economy“
verfolgt. Kreislaufwirtschaft knüpft an
agrargesellschaftliche Erinnerungen
an, in denen die Großmutter ihre Ab-
fälle entweder dem Vieh verfüttert, in
den Boden einackert oder im Herd ver-
heizt. Allerdings ist heute die materielle
Zusammensetzung gesellschaftlicher
Ressourcen eine völlig andere: es domi-
nieren fossile Energieträger und minera-
lische Baustoffe. Fossile Energieträger,
in Industrieländern rund ein Drittel der
Rohstoffe, kann man überhaupt nicht
„im Kreis führen“; dagegen spricht die
Thermodynamik, eines der grundlegen-
den Gesetze der Physik. Man kann sie
bestenfalls „kaskadisch“ nutzen, d.h.
die Abwärme oder die Reststoffe eines
Prozesses noch einmal in einen anderen
einspeisen.
Bau- und Kunststoffe
Soweit Baustoffe, auf deren hohen
Zementanteil erhebliche klimaschäd-
liche Emissionen zurückgehen, „im
Kreis geführt“ werden, handelt es sich
zumeist um Downcycling: mit viel Ener-
gieaufwand werden sie zerkleinert und
in den Unterbau von Straßen und der-
gleichen eingebracht, werden also nicht
für die gleichen Anwendungen wie das
Ausgangsmaterial eingesetzt. Ähnlich
verhält es sich mit Kunststoffen, die
selbst ein Derivat fossiler Energieträger
darstellen. Die vielfältigen, meist opak
gehaltenen Mischformen mit unzähli-
gen Zusatzstoffen sowie die Verteilung
in kleinsten Mengen quer durch die
Haushalte vor allem der Industriegesell-
schaften führen bereits bei der Wieder-
einsammlung durch ihre geringe Dichte
zu einem beträchtlichen Energieauf-
wand pro Kilogramm Material. Abgese-
hen von wenigen Ausnahmen ist dann
nur mehr ein Downcycling möglich, d.h.
es müssen Sekundärmärkte geschaffen
werden. So werden aus Lebensmittel-
verpackungen z.B. Blumentöpfe oder
Prozesswärme, wenn eine stoffliche
Verwertung zu aufwändig wäre.
Metallrecycling
Die besten Aussichten einer Kreis-
laufführung gibt es bei der dritten
Die besten Aussichten einer für den
Ressourcenverbrauch umweltverträglicheren
Kreislaufführung gibt es bei Metallen.
Ressourcen – Wirtschaft – Ökologie
UNEP-IRP (2011), Fischer-Kowalski, M. / Swilling, M. (2011):
Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth.
http://tinyurl.com/6yg7affSverdrup, H. / Ragnarsdottir K.V. (2014): Natural Resources
in a Planetary Perspective.
http://tinyurl.com/hqjp4a2Wiederverwertung kann innovative Wege gehen
ª