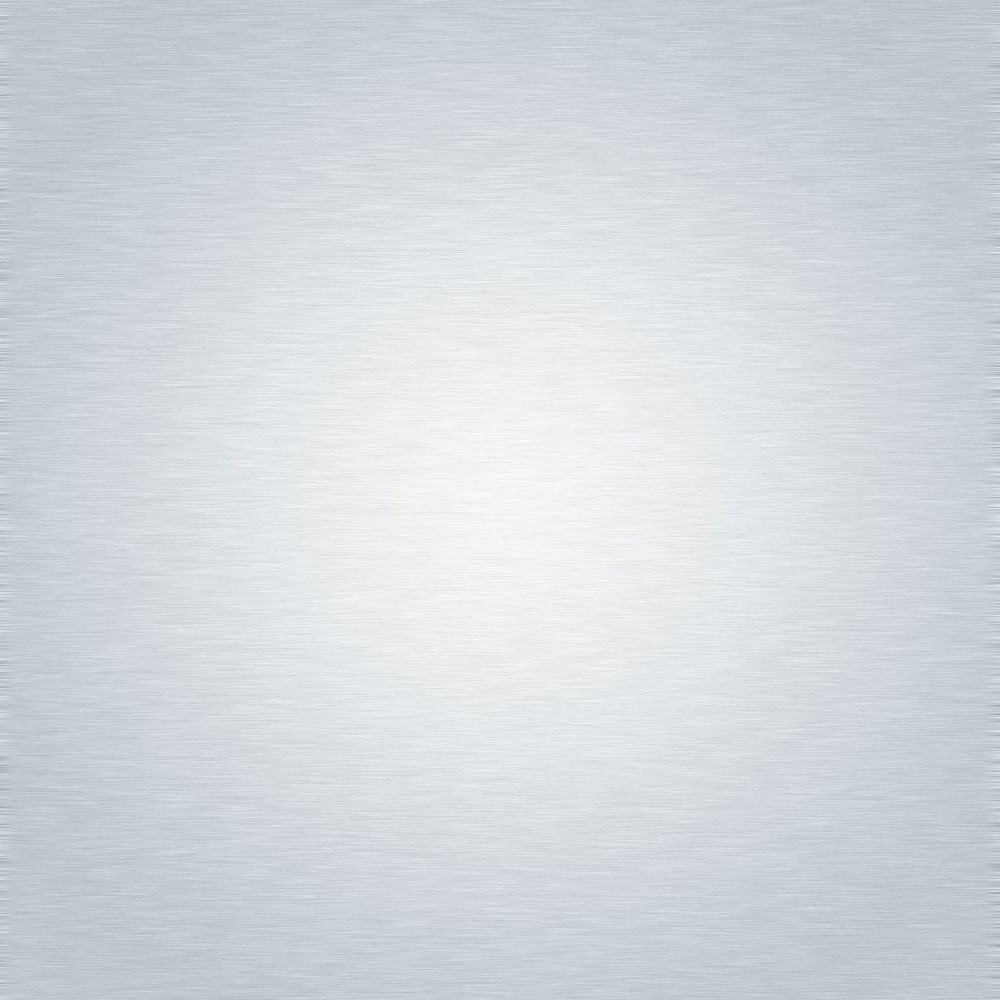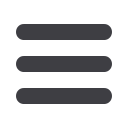
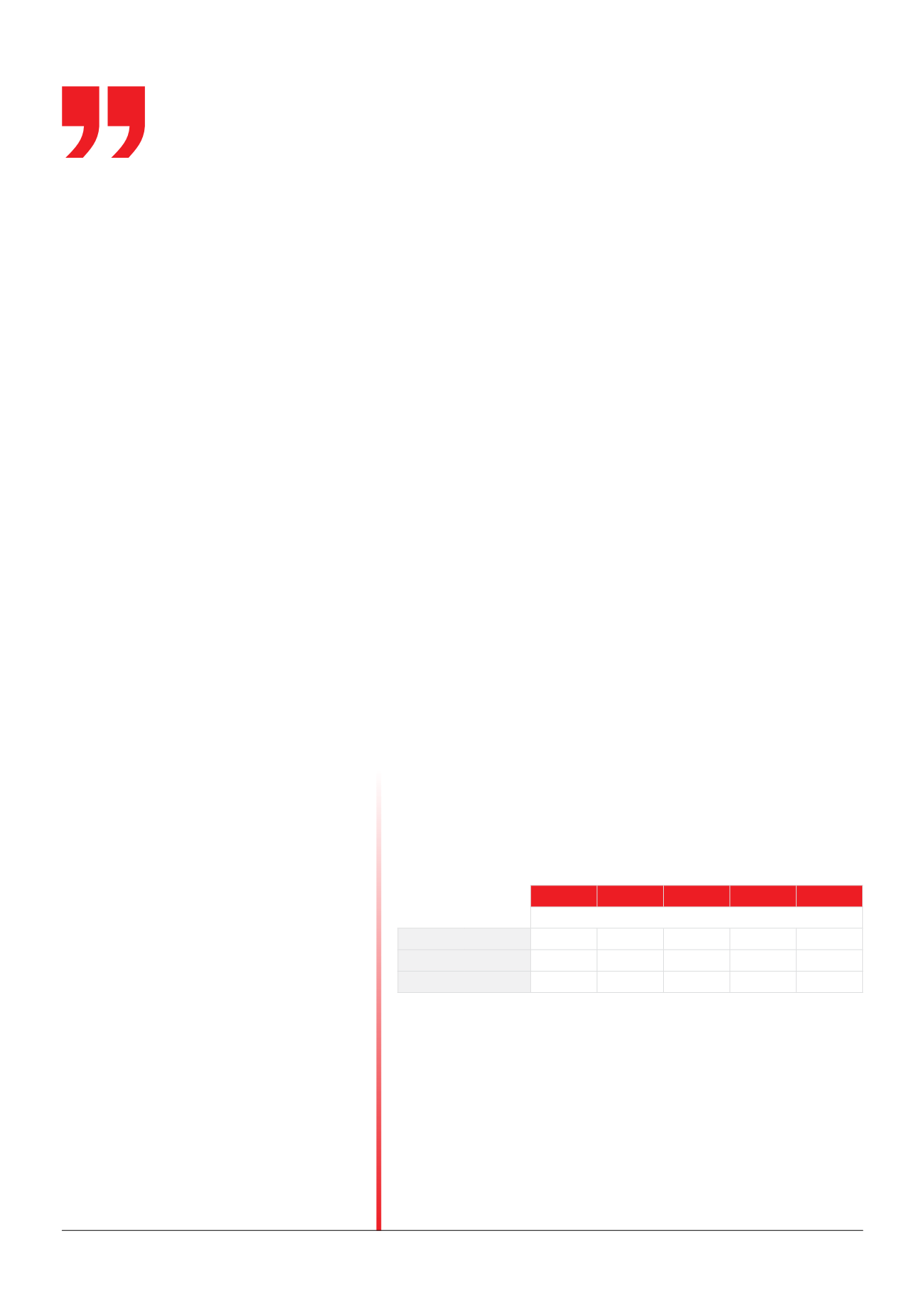
Ammoniak
Eigentliches Problem der Verhand-
lungen war jedoch Ammoniak (NH
3
),
des fast nur in der Landwirtschaft durch
Düngung und Massentierhaltung anfällt.
In der Umgebungsluft wandelt es sich
in Ammoniumsulfat und -nitrat und bil-
det sekundären Feinstaub. Ammoniak
belastet zudem das Grundwasser und
bildet zusammen mit NO
x
bodennah-
es Ozon. Die EU-Kommission hat auf-
grund ihrer Erhebungen landwirtschaft-
liche Großbetriebe als Hauptverursacher
identifiziert, bei denen effiziente Maß-
nahmen für eine gesunde Luft ergriffen
werden können. Primär geht es um die
Abdeckung und bodennahe Ausbrin-
gung von Gülle, die bei der Massentier-
haltung anfällt. Österreich müsste für die
Einhaltung der Emissionshöchstgrenzen
bei Ammoniak eigentlich nur Maßnah-
men setzen, die nur wenige Agrar-Groß-
betriebe betreffen. Weil die heimische
Politik generell die Landwirtschaft vor
jeglichen Auflagen, auch vorsorglich für
erheblichen Produktionsausweitungen
von Milch und Schweinefleisch in ferner
Zukunft, schützt, stimmte Österreich im
Dezember 2015 im Verein mit Bulgarien,
Dänemark, Polen und Rumänien gegen
den NEC-Vorschlag. Die Mehrheit der
EU-Mitgliedstaaten hatte dagegen keine
Probleme.
Hypothek
Ein einmaliger Betriebsunfall des
„Umweltmusterlandes Österreich“ ist
dies jedoch nicht. Österreich hat auch
zuvor auf EU-Ebene gegen das neue
Göteborg-Protokoll gestimmt und lehnt
bis heute eine Ratifikation ab. Verbind-
liche Maßnahmen zur Einhaltung der
NEC-Emissionshöchstmengen konnte
Österreich seit 2003 nie vorlegen. Au-
genscheinlich ist die Unvereinbarkeit
von Umwelt und Landwirtschaft in ei-
nem Ministerium, das im Zweifel immer
die Landwirtschaftskarte zieht. Bei NO
x
-
Emissionen ist die steuerliche Bevorzu-
gung von Diesel ausschlaggebend, die
zu einem hohen Anteil von Diesel-Pkw
führte. Diese Hypothek für die öster-
reichische Luftreinhaltung ist auch der
Grund, warum Fortschritte bei der in-
ternationalen Zusammenarbeit blockiert
werden, obwohl es eigentlich mehr
durch „importierte“ als durch „haus-
gemachte“ Luftverschmutzung betrof-
fen ist (siehe Kasten Seite 20, Beispiel
Wien-Rinnböckstraße). Hinzu kommt,
dass alle EntscheidungsträgerInnen aus
freien Stücken längst nicht mehr bereit
sind, Verantwortung für konkrete Maß-
nahmen zu übernehmen. Daran wird
auch die neue NEC-Richtlinie nichts
ändern, weil die EU-Zielerfüllung erst im
Jahr 2030 fällig ist.
In den letzten Jahren hat sich die
Luftverschmutzung etwas verringert.
Alle Gebiete können die Zahl der EU-
rechtlich zulässigen Tagesgrenzwert-
überschreitungen bei Feinstaub (PM
10
)
dank günstiger Wetterbedingungen (vor
allem warme Winter und weniger Inver-
sionswetterlagen) und erster Erfolge bei
Luftreinhalte-Maßnahmen einhalten.
Ausnahme ist nur die Stadt Graz, die
aufgrund ihrer Beckenlage EU-Vorga-
ben klar überschreitet, aber von der EU-
Kommission einstweilen keine Sanktio-
nen zu fürchten hat.
Umgebungsluft
Symptomatisch für Österreich ist,
dass das Immissionsschutzgesetz Luft
(IG-L) bei Grenzwerten formal stren-
ger als die EU-Luftqualitätsrichtlinie
(RL 2008/50/EU) ist, in der „gelebten
Praxis“ jedoch nur EU-Vorgaben ernst
genommen werden. Zu den Hauptver-
ursachern von PM
10
zählen der Verkehr,
der Hausbrand und die Industrie. Beim
Verkehr ist ein Großteil auf Diesel-Kfz-
Abgase und die Straßenaufwirbelung
zurückzuführen, beim Hausbrand sind
dies vor allem veraltete Einzelöfen. Um
eine Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte „wetterunabhäniger“ oder gar die
WHO-Empfehlungen sicherzustellen,
bedarf es weiterer Maßnahmen auf al-
len politischen Handlungsebenen. Ohne
EU-Veranlassung ist dies bei Österreich
freilich nicht absehbar.
¨
NEC*-Reduktionserfordernisse der
EU-Mitgliedstaaten bis 2030
Die Einigung im EU-Umweltminister-
Rat im Dezember 2015 ergibt aber
ein anderes Bild: Österreich muss
bei Ammoniak (NH
3
), Schwefeldi-
oxid (SO
2
), flüchtigen Kohlenwas-
serstoffen außer Methan (NMVOC)
und Feinstaub (PM
2,5
) weniger
reduzieren. Nur bei Stickoxiden
(NO
x
) liegt Österreich wegen seiner
Diesel-Pkws leicht darüber. Die
heimische Wirtschaft lehnt Höchst-
grenzen für die Emission von
Luftschadstoffen (NEC/National
Emission Ceilings) wegen überhöh-
ter Vorgaben („golden plating“) im
Vergleich zum EU-Durchschnitt und
zu den neuen EU-Beitrittsstaaten
ab.
* NEC / National Emission Ceilings / Angaben in Prozent, Basis Jahr 2005 = 100 Prozent
Quelle: Einigung im EU-Umweltminister-Rat im Dezember 2015.
Das EU-Maßnahmenpaket hat eines deutlich
aufgezeigt: Ein gemeinsames Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt ist untragbar.
www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 1/2016
Seite 13
SO
2
NO
x
NMVOC
NH
3
PM
2,5
Reduktionserfordernisse in Prozent, Basisjahr 2005
Österreich
-41
-71
-36
-18
-46
EU-Durschnitt
-70
-69
-43
-21
-50
EU-Beitrittsstaaten
-71
-58
-46
-26
-68